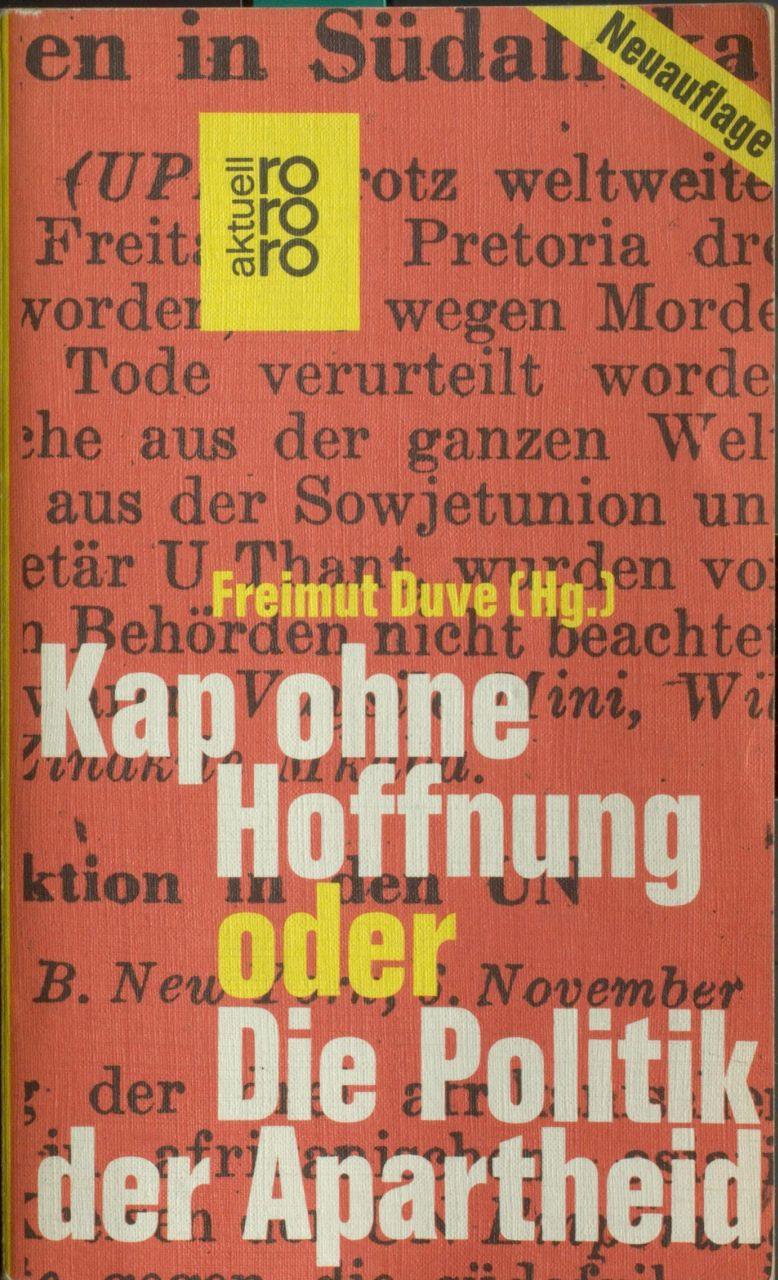Freimut Duve (Hg.), Kap ohne Hoffnung oder Die Politik der Apartheid, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1965,
2. Aufl. 1978.
In den 1960er-Jahren verbreitete sich die Kritik am südafrikanischen Apartheid-Regime weltweit. Aber die Bundesrepublik unterhielt gleichzeitig hervorragende und privilegierte Beziehungen zu den weißen Rassisten am Kap. Südafrika galt als natürlicher Verbündeter im Kalten Krieg gegen den Kommunismus und als Garant für die Sache des Westens im risikoreichen Dekolonialisierungsprozess auf dem schwarzen Kontinent.
Am Ende der Ära Adenauer äußerten sich Intellektuelle zunehmend kritisch über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik, die Pläne zur Atombewaffnung der Bundeswehr, eine sterile Deutschlandpolitik, Verletzungen rechtsstaatlicher Prinzipien beim Polizeieinsatz gegen den »Spiegel«, die »Schubladengesetze« für den Notstand und vieles andere. 1965 tobte ein verbaler Krieg zwischen Ludwig Erhard, dem Nachfolger Adenauers im Kanzleramt, und kritischen Intellektuellen, die Erhard auf öffentlichen Veranstaltungen als »Uhus« und »Pinscher« verunglimpfte.
In jenem Jahr erschien das Buch »Kap ohne Hoffnung« als Band der legendären Reihe »rororo aktuell«. Der Rowohlt-Verlag hatte diese Reihe als Instrument zur raschen Intervention in die politischen Auseinandersetzungen vier Jahre zuvor aus der Taufe gehoben; der erste Band, herausgegeben von Martin Walser, hatte Positionen von Schriftstellern zur Bundestagswahl 1961 gesammelt (»Die Alternative oder Brauchen wir eine neue Regierung?«). Die Reihe galt in den folgenden Jahren als erste Adresse linksintellektueller politischer Stellungnahmen.
Dass Freimut Duve, damals 29-jähriger Promovend, später Bundestagsabgeordneter der SPD sowie Lektor der Reihe, bei Rowohlt einen Band zum Apartheid-Regime herausbringen konnte, wirft ein erstes Schlaglicht auf den Stand der Diskussion in der Bundesrepublik. Mitte der 1960er-Jahre erschienen Schriften von Aktivisten und Theoretikern des antikolonialen Befreiungskampfes, von Frantz Fanon,[1] Che Guevara und Mao Zedong. Man empfand sich in einer existentiellen globalen Auseinandersetzung, in der sich die Konstellationen des Kalten Krieges und des antikolonialen Befreiungskampfes überlagerten.
Vermuten könnte man, dass sich »Kap ohne Hoffnung« in diesem Diskurs unzweideutig als parteilicher Text für die Menschenrechte und gegen den Rassismus verortet hätte. Aber die Botschaft des Bandes war komplizierter. In seinem Vorwort kritisierte Duve zwar »die Ungleichheit der Menschen« (S. 9), betonte jedoch vor allem die Gefahr, die von der Apartheid-Politik für die Weißen selbst ausgehe; »die stärkste Kritik des Westens« erfolge »aus der Sorge um die Konsequenzen« (ebd.). Noch sei die Opposition der Schwarzen, die Gleichberechtigung forderten, nicht rassistisch. Aber die Apartheid-Politik schaffe sich einen »rassistischen Gegenpol« (ebd.). Wenn der Kurs der »letzten rassistischen Kaste dieser Welt« (S. 11) nicht umgehend geändert werde, könnten die traurigen Ergebnisse nur gewalttätige Auseinandersetzungen und schließlich die Vertreibung der Weißen aus Südafrika sein.
Die weißen Südafrikaner schilderte Duve als ideologisch hochgradig verblendet. Mit einem heiligen Fanatismus hingen sie an ihrer Illusion, dass nur eine »immer schärfere Rassentrennung zur Wohlfahrt aller Südafrikaner« führen werde (S. 8). Wohlgemerkt, der Herausgeber wandte sich gegen die Radikalisierung der Apartheid-Politik, nicht gegen die Vorherrschaft der Weißen in Südafrika an sich. Der Band sollte allerdings vor allem dokumentieren, welche Positionen es überhaupt gab. Und hier verbarg sich die zweite, weniger explizite Botschaft des Buches, denn die aufgenommenen Texte entfalteten beim Leser unter Umständen eine Wirkung, die nicht unbedingt den Intentionen des Herausgebers entsprach.
Der erste Artikel stammt von Werner W. Max Eiselen (1899–1977), einem ehemaligen Staatssekretär der südafrikanischen Regierung mit blendenden Beziehungen nach Deutschland. Sein Beitrag sollte dazu dienen, das »offizielle Programm« der Apartheid zu dokumentieren (Klappentext). Eiselens Legitimation des »Regierungsprogramms der getrennten Entwicklung« (S. 12) kann als ideologischer Schlüsseltext gelesen werden. Er drehte Duves Vorwurf der Verblendung durch die Propaganda des Regimes um und verbat sich »destruktive Kritik, die hauptsächlich auf unzureichenden Informationen und Vorurteilen beruhte« (ebd.). »Südafrika, repräsentiert durch die Mehrheit der weißen Wählerschaft und, wie man mit gutem Grund annehmen kann, durch jene großen Teile der nichteuropäischen Bevölkerung, die intelligent und differenziert genug sind, um zu merken, was auf dem Spiele steht« (S. 14), habe sich entschieden, den unterschiedlichen kulturellen Standards und Idealen Rechnung zu tragen. Eiselen beschwor das Menetekel einer »völlig neuen Gesellschaft […], die jedenfalls nach Charakter und Kultur nicht europäisch wäre« (ebd.). Er schloss mit dem Appell, dass die westlichen Länder zu ihrem eigenen Vorteil dem Apartheid-Regime erlauben sollten, »auf unserem Wege fortzufahren, ungestört bei der Erfüllung unserer zugestandenermaßen schwierigen Mission« (S. 23).
Die folgenden Texte dementierten die harmonistische Ideologie durch praktische Beispiele. Alan Paton (1903–1988), preisgekrönter südafrikanischer Schriftsteller und Oppositionspolitiker, schilderte in der »Charlestown Story« die Enteignung und Vertreibung von Schwarzen, die sich Land gekauft oder gepachtet hatten, auf Basis der Apartheid-Gesetze von 1948. Dadurch sei das Vertrauen in den von Weißen regierten Rechtsstaat zerstört worden, »eine trostlose Geschichte […] voller Gemeinheit« (S. 35). Anthony Sampson (1926–2004), ein liberaler südafrikanischer Journalist und Redakteur beim britischen »Observer«, wies auf die selektive Wahrnehmung der weißen Südafrikaner hin, deren Wohngebiete »so ruhig, so wohlhabend und so wohlgeordnet« erschienen (S. 37), dass man den gleichzeitigen Terror gegen die Opposition gar nicht sehe, die »allmächtige Geheimpolizei«, die Möglichkeit der 90-Tage-Haft gegen Schwarze ohne Angabe von Gründen. Der politisch verfolgte Journalist Brian Bunting (1920–2008) schrieb über das südafrikanische Bildungssystem, das in den Dienst der Apartheid gestellt worden sei und vor allem der Forderung nach einem allgemeinen Wahlrecht entgegenwirken solle; »Rassenvorurteile in ihrer plumpesten Form« fänden sich in den Erziehungsrichtlinien für die »nicht der weißen Rasse angehörigen Schüler« (S. 54).
Den umfangreichsten Aufsatz des Bandes steuerte der Herausgeber bei und ergriff die Gelegenheit, die in seinem Vorwort angedeuteten weltpolitischen Zusammenhänge näher auszuführen. Die südafrikanische Rassenpolitik befinde sich im Schnittpunkt »der zwei großen Koordinationssysteme aktueller Weltgegensätzlichkeiten«, nämlich des Ost-West-Konflikts und der sich zuspitzenden »Weltteilung in reiche weiße und nichtweiße arme Nationen« (S. 67). Das schwarze Afrika sei in seinem Kampf gegen das von Weißen dominierte Südafrika zwar militärisch schwach, aber es sei nicht zu bezweifeln, dass dem Osten aus dem Fortbestehen weiterer Kolonien beziehungsweise unabhängiger weißer Minderheitsdiktaturen argumentative Vorteile erwachsen würden. »Nirgends sonst auf der Welt kann der Kommunismus seine Analysen der Klassengesellschaft und des Kolonialismus zu einer derart stimmigen Einheit verschmelzen wie in Südafrika.« (S. 72) Als die gefährlichste Bedrohung erschien aber nun nicht mehr Moskau, sondern Peking, biete doch »die Verschärfung des Klassengegensatzes durch die Rassentrennung der Synthese von militantem Rassismus und Kommunismus chinesischen Gepräges ein noch viel dankbareres Propagandafeld als dem russischen Anti-Kolonialismus« (ebd.). Zu beobachten sei eine panafrikanische Strategie, in der der Kongo, ein »anarchisches Machtvakuum« (S. 75), das weite Aufmarschgebiet für einen kommenden Krieg gegen Südafrika abgebe. Die weißen südafrikanischen Söldner dort »verteidigen Südafrika am Kongo. Das nächste Ziel der Panafrikanisten ist dann Angola.« (ebd.)
Letztlich, so Duve, gehe es darum, ob die südafrikanische Regierung es schaffe, den nichtweißen Bevölkerungsteil auf ihre Seite zu ziehen oder mindestens ruhigzustellen, bevor ein Angriff von außen erfolge. In diesem Zusammenhang entfaltete er eine immanente Kritik. Die weißen Südafrikaner wollten »nicht die Opfer aufbringen, die zu einer wirklichen Durchführung der von ihnen gewünschten Politik notwendig wären« (S. 78). Erfolgversprechend wäre es nur, die schwarzen Wohngebiete »durch großzügige Planung zu industrialisieren«, langfristige Darlehen an Schwarze zur Ankurbelung des privaten Unternehmertums zu geben, »die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Bantustan [d.h. der Homelands] zu schaffen« (S. 82). Spätestens hier verließ Duve den Pfad einer prinzipiellen Kritik der Apartheid und nahm die Perspektive innerer Reformen in Südafrika auf der Basis weißer Vorherrschaft ein. Die Kritik an der ideologischen Verblendung der weißen Südafrikaner, denen er immer wieder »illusionäres Denken« (S. 88) attestierte, bezog sich darauf, dass sie nicht erkennen würden, wie sie am wirksamsten ihre Herrschaft sichern könnten. Aus Angst vor einer Majorisierung durch die Schwarzen vollziehe sich eine stetige Radikalisierung der weißen Mittelschichten, und »jeder Versuch, die Apartheid gerechter zu gestalten, scheitert an der Machtstruktur der weißen Wählerschaft« (S. 89). Die bizarre Vorstellung einer gerechten Apartheid zeigt die ganze Hilflosigkeit einer Position, in der sich das Engagement für Menschenrechte mit der Parteinahme für den Westen im weltweiten Kalten Krieg verband.
Es gebe vier Möglichkeiten für den Westen: »das weiße Regime ganz offen als die einzige militant antikommunistische Macht des Kontinents« zu unterstützen (S. 73); Druck auf das Regime auszuüben, seine Position zu ändern; die schwarze Opposition zu unterstützen; absolute Neutralität zu üben. Die erste Position werde nur von Portugal eingenommen, die zweite von den USA und Großbritannien, die dritte von niemandem (und nur die skandinavischen Länder hätten ihre Handelsbeziehungen gedrosselt); die vierte von der Bundesrepublik, zumindest offiziell. De facto komme das aber der ersten Variante nahe, nämlich der Unterstützung der Apartheid. So hatte sich die Bundesregierung in Südafrika dafür entschuldigt, als der DGB 1960 zum Boykott von Produkten aus Südafrika aufgerufen hatte. Dividenden von 12 bis 27 Prozent für deutsche Unternehmen am Kap, meinte Duve, seien nicht günstig für eine kritische Öffentlichkeit. Die in der Bundesrepublik vorgetragenen Argumente für die Unterstützung des Apartheid-Regimes, es handle sich um einen »zuverlässigen antikommunistischen Freund« (S. 91), um »weiße Brüder« (S. 92) und um eine reiche, stabile Wirtschaft, kritisierte Duve vornehmlich aus der Perspektive, dass sie von der Propaganda der DDR ausgenützt würden, die auf eine angebliche »Achse Bonn – Kap« ziele (S. 93).
Die den Band abschließenden Beiträge aus Südafrika wirken auf den Leser als starker Kontrast zu dieser weißen Bänglichkeit. Shula Marks (Jg. 1936) gab sehr sachlich Auskunft über die Geschichte des ANC und seine Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei Südafrikas. Diesen Aspekt, in der Spätblüte des aggressiven Antikommunismus für westdeutsche Leser besonders verstörend, sprach auch Nelson Mandela in seiner – auszugsweise dokumentierten – Verteidigungsrede bei seinem Prozess 1964 an. Unter der Überschrift »Ich bin bereit zu sterben« bekannte er sich zu Sabotageaktionen und erklärte eindrücklich, warum die Politik der Gewaltlosigkeit verlassen werden müsse. Seine Vision einer Gesellschaft für alle in Südafrika, frei von Rassenschranken, hinterlässt auch heute den stärksten Eindruck eines nicht durch strategische Überlegungen halbierten Humanismus.
Der sehr informative Band – er enthält im Anhang Dokumente zur Rassengesetzgebung, zu den Methoden der Polizei und eine Liste der in Südafrika verbotenen Literatur – vermittelt einen guten Einblick in den Stand der beginnenden Diskussion über das Apartheid-Regime in der Bundesrepublik. Als der Verlag wegen der großen Nachfrage 1978 eine unveränderte Neuauflage herausbrachte,[2] schrieb Freimut Duve im Vorwort: »Inzwischen ist aber auch die damals noch mögliche liberale Hoffnung auf eine friedliche vielrassische Gesellschaft ihrerseits schon wieder Geschichte geworden, das heißt, die friedliche Lösung ist immer weniger wahrscheinlich geworden.«
Anmerkungen:
[1] Zu Fanons Buch »Die Verdammten dieser Erde« (in deutscher Übersetzung zuerst 1966 bei Suhrkamp erschienen, 1969 dann auch bei »rororo aktuell«) siehe Andreas Eckert, Predigt der Gewalt? Betrachtungen zu Frantz Fanons Klassiker der Dekolonisation, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3 (2006), S. 169-175.
[2] Siehe zu weiteren rororo-Bänden den Beitrag von Hanno Plass in diesem Heft.