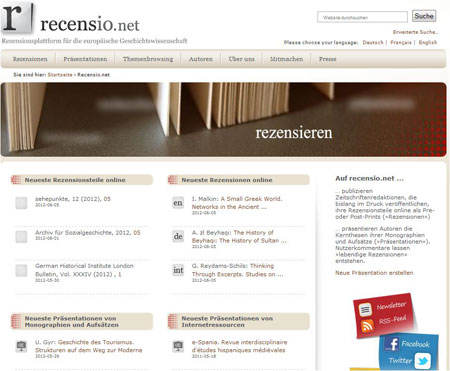Ganz gegensätzlich zum teils immer noch lebendigen Vorurteil vom weltfremden Historiker, der lieber in staubigen Archiven wühle als sich im Netz zu tummeln, waren gerade die Geschichtswissenschaften sehr früh dabei, als in den 1990er-Jahren erste Versuche stattfanden, die Potenziale von Netzpublikation und -kommunikation auch für die Geisteswissenschaften fruchtbar zu machen. Viele der damaligen Initiativen haben sich – nicht zuletzt durch das Engagement Einzelner – bis heute gehalten, sich stetig weiterentwickelt und sind inzwischen Plattformen geworden, die wichtige Rollen im Arbeitsalltag der Wissenschaftler spielen, denken wir etwa an „H-Soz-u-Kult“ oder an die „sehepunkte“.
Nichtsdestotrotz hat man – vermutlich muss man sagen: immer noch – den Eindruck, als stünden netzaffine Fachvertreter für eine eigene Richtung, für eine eigene (thematische) Kategorie; als könne man sich entscheiden, ob man die Möglichkeiten des Internet als Historiker grundsätzlich nutzt oder grundsätzlich ignoriert und sich lieber mit anderen Themen beschäftigt. Generell hat sich zwar die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Entwicklung nicht nur zeitgemäßer, sondern zukunftsorientierter Netzstrukturen für das Fach essenziell ist und dass dafür Experten notwendig sind. Das ist gut und richtig. Doch zugleich gibt es einen anderen Teil des Fachs, der sich wenig bis gar nicht mit den immensen Umwälzungen beschäftigt, die die Netzkultur für die Produktion und Rezeption von Wissen insgesamt bedeutet. Dieser Teil – das sage ich zunächst ganz wertfrei – nutzt das Internet genauso intensiv, wie es unbedingt nötig ist, und empfindet die sich abzeichnenden Umbrüche als tendenziell existenzbedrohend für die abendländische Gelehrtenkultur. Zwischen beiden Polen gibt es eine große Menge forschender Historiker und Studierender, die offen sind für Angebote, die ihren Arbeitsalltag erleichtern, ihr Blickfeld erweitern oder Arbeitsprozesse vereinfachen, beispielsweise das Publizieren.
„recensio.net“ ist als DFG-gefördertes Gemeinschaftsprojekt der Bayerischen Staatsbibliothek, des Deutschen Historischen Instituts Paris und des Instituts für Europäische Geschichte Mainz Anfang 2011 online gegangen, um genau solche Angebote zu machen. In erster Linie versteht sich die Plattform als eine, die Übersicht schafft in einem immer unübersichtlicheren Rezensionsmarkt mit immer mehr Rezensionsorganen, die verstreut auf Papier oder im Netz (oder in beidem) erscheinen. Indem sie mit Zeitschriftenredaktionen kooperiert, die Rezensionen publizieren, nimmt sie die Rolle eines „Open-Access-Aggregators“ wahr und publiziert – gewissermaßen als Dienstleister dieser Redaktionen – deren Buchbesprechungen ein zweites Mal, unabhängig davon, wo und wie sie zum ersten Mal erschienen oder davon, ob sie bereits andernorts im Netz zugänglich sind. Dabei grenzt sich „recensio.net“ deutlich von bestehenden Angeboten ab, etwa von „H-Soz-u-Kult“, wo eigenständig Rezensionen generiert werden, oder auch von den „Historischen Rezensionen Online“, die eine organübergreifende Metadatensuche anbieten. Ziel von „recensio.net“ ist es, alle Rezensionen gleichermaßen im Volltext durchsuchbar zu machen – mit Metadaten angereichert, sacherschlossen und direkt auf der Plattform im Open Access zugänglich, um auch die Langzeitarchivierung der Texte gewährleisten zu können. Der Nutzer kann auf die Rezensionen eines bestimmten Fachjournals zugreifen oder aber alle Rezensionen der Plattform nach einem bestimmten Thema, einer Epoche, einem geographischen Raum oder gezielt nach einzelnen Schlagwörtern filtern. Der Sichtbarkeitszuwachs für die einzelne Zeitschrift, für ihre Rezensenten und die Rezensierten liegt auf der Hand. Nach der Startphase sind wir überrascht von der positiven Resonanz sowohl der inzwischen 28 kooperierenden Journale als auch der Nutzer.
2![]()
Neben dieser ersten Säule der Plattform gibt es eine zweite: Sie bedeutet einen Schritt hin zur Erprobung jener Web 2.0-Bewertungsverfahren für den wissenschaftlichen Bereich, wie sie auf dem kommerziellen Buchsektor seit Jahren sehr erfolgreich sind, denkt man beispielsweise an Amazon. Geschichtswissenschaftliche Autoren können die Kernthesen bereits publizierter Schriften direkt auf „recensio.net“ bereitstellen – mit Metadaten, dem Inhaltsverzeichnis und zum Beispiel auch der Coverabbildung versehen. Andere Plattformnutzer, bei denen es sich in der Regel auch um Wissenschaftler(innen) handelt, können diese Präsentationen inhaltlich kommentieren. Im Idealfall entsteht dabei eine „lebendige Rezension“, ein direkter Austausch, da der Präsentierende automatisch benachrichtigt wird, sobald ein Kommentar eingeht. Um diejenigen auf die Präsentation aufmerksam zu machen, die mit dem jeweiligen Thema am vertrautesten sind, kann der Autor im Präsentationsformular „Bezugsautoren“ angeben – Kollegen also, auf deren Publikationen er aufbaut, mit deren Werk er sich auseinandergesetzt hat. Die Plattform informiert diese über die Veröffentlichung und ihre Kommentarmöglichkeit.
Innovativ an dieser zweiten Säule ist zuvorderst natürlich die Möglichkeit, sich partikular, fragmenthaft zu äußern: Ein Kommentar ist seinem Wesen nach keine in sich abgeschlossene Rezension, sondern kann und darf auch Details herausgreifen. In ihrer Gesamtheit aber bilden solche Kommentare eine neue, fluide und dem Facettenreichtum unterschiedlicher Meinungen angepasste Form des Rezensierens. Kommentar und Replik stehen zusammen, wo sich früher die Folge von Rezension und Stellungnahme – wenn überhaupt – über lange Zeiträume und unterschiedliche Ausgaben einer Zeitschrift vollziehen konnte. Daneben ist neu, dass Autoren nicht nur Monographien, sondern ebenso Aufsätze präsentieren können, die sie in Zeitschriften oder Sammelbänden veröffentlicht haben. Aufsätze blieben bislang – sieht man vom nicht ganz unproblematischen Genre der „Sammelbandrezension“ ab – vom Rezensionsgeschäft ausgeschlossen. Dabei müssen diese Präsentationen deutlich über das inhaltliche Niveau von „Klappentexten“ hinausgehen, um auf „recensio.net“ publiziert zu werden. Es soll sich vielmehr um kondensierte, klar und pointiert aufbereitete Darstellungen der Kernthesen einer Publikation handeln, um dem kritischen Leser das Anknüpfen per Kommentar zu ermöglichen. Schließlich können auch Internetressourcen für Historiker (Datenbanken, Websites, Publikationsportale u.v.m.) präsentiert werden, wobei durch die zeitlich unbegrenzte Kommentarmöglichkeit der permanenten Veränderung dieser Ressourcen Rechnung getragen werden kann.
Als Charakteristikum des Internet und besonders des Web 2.0 wird oft betont, dass sich Nutzer zu Produzenten, Empfänger zu Sendern wandeln. Unter Wissenschaftlern gab es diese Doppelrollen schon immer, insbesondere im Rezensionswesen: Der Rezensent ist in aller Regel zugleich auch Rezensierter, jeder Sender auch Empfänger. Wichtig aber ist die Feststellung, dass das Internet eine Offenheit gegenüber „Laien“ (aus fachwissenschaftlicher Warte) nicht nur erleichtert, sondern geradezu erzwingt. Damit geht die Aufgabe einher, dies nicht als Bedrohung der oft hermetisch in sich verschlossenen Wissenschaftlerkreise zu empfinden, sondern als Bereicherung. Zudem hat es auch etwas mit gesellschaftlicher Legitimation zu tun. Eine Wissenschaft, die nur zum Nutzen und zur Kenntnis der sie betreibenden Wissenschaftler forscht und publiziert (wie es in der deutschen Geschichtswissenschaft im Gegensatz etwa zum angelsächsischen Raum häufig praktiziert wird), hat – möglicherweise zu Recht – einen schweren Stand in der sie finanzierenden Öffentlichkeit.
3![]()
Auf „recensio.net“ sind alle Interessierten, selbstverständlich auch Laien, eingeladen zu lesen und zu kommentieren, sofern dabei Spielregeln und redaktionell definierte Qualitätsstandards eingehalten werden. Gerade die Geschichtswissenschaften können in vielen Bereichen, nicht nur in genealogischen und zeitgeschichtlichen, vom verteilten Fach- bzw. Detailwissen der „Crowd“ profitieren. Welches Medium könnte da geeigneter sein als das Internet, wo traditionelle Hierarchien par principe außer Kraft gesetzt sind, wo der Kommentar eines Professors gleichwertig neben dem eines Hobbyforschers steht, ja häufig nicht einmal als solcher erkannt werden kann, sofern keine Klarnamen verwendet werden? Diese Situation kann man als Demokratisierungsprozess befürworten oder aber als Ent-Professionalisierung kritisieren. Sicher ist jedoch, dass sie ein wesentliches Merkmal der Kommunikation im Internet ist – dies zeigen nicht zuletzt die immer wieder aufflammenden Diskussionen um die Wikipedia.1
Die beschriebene Tendenz kollidiert mit dem Wert, der gerade im deutschsprachigen Raum traditionell auf akademische Titel und Meriten gelegt wird; sehr viel mehr als beispielsweise in Frankreich oder Großbritannien. Die Angst vieler Wissenschaftler, dass durch Kommunikationsformen des Web 2.0 die eigene Position an Wert verlieren werde, man also auf Augenhöhe mit einem oft anonymen Gegenüber argumentieren müsse, wirkt hier abschreckender als anderswo. Damit einhergehend hält sich eine Gelehrtenkultur, in der das einmal geschriebene oder öffentlich gesprochene Wort etwas überaus Verbindliches hat. Meinungswandel gilt oft als Schwäche. Das ist ein Punkt, der der Netzkultur zutiefst zuwiderläuft; diese basiert auf Wandel, auf dem Fragment, ja auch auf einer solch großen Masse an Fragmenten, dass ein erheblicher Teil davon sicher irrelevant ist. Aber ein funktionierendes Web 2.0 lebt von einer aktiven „Crowd“, die Argumente permanent filtert sowie einmal getroffene Feststellungen in Aktualisierungen und Kommentaren jederzeit relativieren, erweitern, notfalls auch revidieren kann. Das ist zugleich der Mechanismus, auf dem Wissenschaft ihrem Wesen nach fußt. Gerade die Geisteswissenschaften jedoch haben sich über Jahrhunderte an eine schwerfällige Papierkultur gewöhnt, die diesen Prozess nur sehr bedingt abbilden kann, die aber als ein Wert an sich betrachtet wird. Die Umstellung auf eine Netzkultur bedeutet nichts weniger als einen Paradigmenwechsel, der allerdings immense Chancen birgt und der Logik der Wissenschaft keineswegs widerspricht, im Gegenteil.
Ich halte die beschriebenen – und vielleicht nur unterschwellig bestehenden – Ängste für wichtige Einflussfaktoren der Tatsache, dass in Frankreich etwa nicht nur die Zahl, sondern auch die Akzeptanz geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriften in „goldenem Open Access“2 viel größer ist als in Deutschland. Die Kultur wissenschaftlicher Blogs ist ebenfalls ungleich weiter entwickelt – Blogs als Gradmesser der Bereitschaft, schon in frühem Stadium Forschungsthesen und -ergebnisse zu teilen, sie im Austausch mit anderen zu erweitern, zu diskutieren; das zögerliche Aufgreifen der Blogkultur hierzulande zugleich als Gradmesser der Sorge, dass damit die eigene Erkenntnis feindlich erobert werden könnte. „Wissen als Besitz“ ist eine Kategorie, die der Grundidee des Internet zuwiderläuft. Wissen mehren durch Teilen ist hier die entscheidendere Kategorie. Es wird noch viel Zeit ins Land gehen, bis dieser Wertewandel sich endgültig und über den privaten Bereich hinaus auch im wissenschaftlichen Terrain Bahn bricht.
4![]()
Spricht man mit traditionellen Fachvertretern (wobei die Generationenfrage eine Rolle spielt, aber längst nicht ausschließlich), so tauchen oberflächlich immer wieder die Qualitätszweifel auf, oft pauschal „dem Internet“ gewidmet, ganz sicher aber der Kommentarkultur, die als eine Kultur unüberlegter Schnellschüsse erscheint. Mit fortschreitender Zeit jedoch dürfte sich die Erkenntnis durchsetzen, dass das Medium an sich kein Qualitätsgarant sein kann, dass auch das Papier nie ein solcher war, dass aber umgekehrt das Internet hervorragende Voraussetzungen liefert, um Qualität zu filtern und zu verbreiten, um die prozentual sicher größere Menge an Nichtqualität zu identifizieren und selbst ihr ein Maß an Informationsgehalt zuzubilligen, das ihre Existenz auf den Datenservern rechtfertigt: Auch die schlechteste Dissertation nützt dem nächsten Forscher möglicherweise in Detailfragen – ungleich stärker als eine Präsenz auf Papier, allein schon aufgrund der leichteren Such- und Findbarkeit jener Details. Bezogen auf Wissenschaftsblogs: Auch wenn nur zwei von zehn Kommentaren Hinweise enthalten, die den aktiv oder passiv Beteiligten der Diskussion eine neue Anregung zur Fortführung eines Forschungsansatzes liefern, ist dies besser, als keinen der zehn Kommentare je erhalten zu haben. Wer thematisch involviert ist und Austausch sucht, der filtert – und ist auch bereit dazu. Wer nicht involviert ist und von außen zusieht, schüttelt ob der acht minderwertigen Kommentare den Kopf und sieht sein Bild vom Netz bestätigt. So ist wohl der Lauf der Dinge.
Um auf „recensio.net“ zurückzukommen: Wir agieren viel vorsichtiger, setzen viel früher an, indem es bei uns weiterhin ausschließlich um wissenschaftliche Thesen geht, die bereits publiziert sind und – meist traditionelle – Begutachtungsprozesse durchlaufen haben. Bei jenen Rezensionen, die „recensio.net“ aus vielen unterschiedlichen Zeitschriften zusammenführt, liegt dies auf der Hand. Dasselbe gilt aber auch hinsichtlich der Präsentationen, die ein Autor zu seinen (publizierten) Schriften einstellen kann. Sie durchlaufen eine redaktionelle Kontrollinstanz innerhalb der Plattform – um den benannten Befürchtungen Rechnung zu tragen und auch aus dem Bewusstsein heraus, dass eine neue Plattform nicht sofort jene Frequenz an Kommentaren erwarten kann, die notwendig wäre, damit ein „reines Web 2.0“-Prinzip funktioniert, das sich im Grunde selbst kontrollieren können muss. Es wird noch dauern, bis die Bedingungen hierfür – größtenteils in den Köpfen und Gedanken aller Beteiligten – gegeben sein werden.
Zu erwarten ist eine lange Übergangsphase, in der Publikations- und Kommunikationstraditionen sowie die Erprobung, die Nutzung oder auch das Verwerfen neuer Kanäle nebeneinander existieren. Ebenso werden einzelne „alte Kanäle“ irgendwann zugunsten für besser befundener neuer Kanäle austrocknen. Diese Übergangsphase wird im Wissenschaftsbetrieb länger als nur ein paar Jahre dauern; es braucht daher Konzepte, um alte und neue Arbeits-, Lese- und Kommunikationsgewohnheiten zu verbinden. Genau das versucht „recensio.net“ im Hinblick auf Rezensionen: Print darf Print bleiben, Zeitschriftenredaktionen können aber zusätzlich die Sichtbarkeit des Internet nutzen. Die klassische, in sich abgeschlossene Rezension steht als Genre gleichberechtigt neben dem neuen, partikularen Ansatz, Rezensionen stehen neben Präsentationen. Aber auch die klassische Rezension darf kommentiert werden. Ebenso profitiert der Nutzer vom Nebeneinander aus Provenienzprinzip (Zugriff über die beteiligten Zeitschriften) und dem netztypischeren Pertinenzprinzip (Auswahl nach Sach- bzw. Suchbegriffen und Themenbrowsing). Und nicht zuletzt profitiert er vom Nebeneinander unterschiedlicher Rezensionen zu einem Werk: Die Suche nach dem Titel einer Neuerscheinung führt im Idealfall zu mehreren Rezensionen verschiedener Fachzeitschriften und einer Präsentation, die dem Leser Möglichkeiten zur eigenen Stellungnahme bietet.
5![]()
Im Netz zu publizieren heißt, sich vom Exklusivitätsgedanken zu verabschieden. Wissen zu teilen setzt voraus, es zu ver-teilen. Das Ver-Teilen auf Papier suggerierte Kontrollierbarkeit, aufgrund der Materialität des Mediums. Das Internet praktiziert keine Kontrolle (pauschal und pointiert gesprochen), ebenso wenig suggeriert es sie, und erscheint daher in diesem Punkt angreifbarer. Wer einen Inhalt in seinen Web-Garten stellt und durch Lizenzbeschränkungen ein Zäunchen drumherum zu bauen versucht, wird möglicherweise erfahren, dass das Wesen des Netzes (Verlinkung, Verbreitung, Offenheit, Belegbarkeit) damit kollidiert, dass verschiedenste Schwierigkeiten entstehen, wohingegen die (freie) Verfügbarkeit eines Texts an vielen Stellen im Netz (zu der auch „recensio.net“ beiträgt) dem Wesen des Internet eher entspricht. Dass Verwerter, die mit dem Gartenzaunmodell – früher auf Papier, heute im Netz – jahrhundertelang gut fuhren, vor diesem Hintergrund schrittweise neue Ideen brauchen, steht außer Frage. Ausschlaggebend für meine Sichtweise aber, die allein jene der Wissenschaft ist, ist die ganz praktische Tatsache, dass die Offenheit des Netzes inhaltlichen Profit für die Forschung bedeutet, denn diese baut auf der Verfügbarkeit von Wissen auf. Sie profitiert auch methodisch und qualitativ, denn dass beim munteren Datenaustausch von Dokumenten, die an vielen Orten im Netz gleichzeitig liegen, wissenschaftliche Spielregeln eingehalten werden müssen (auch weil der Verstoß dagegen viel offenkundiger ist als im Papierzeitalter), liegt auf der Hand. Der Umgang mit Zitierregeln, Quellennachweisen und Belegen wird langfristig gestärkt, nicht geschwächt werden.
1 Siehe auch den Beitrag von Jan Engelmann in diesem Heft.
2 Gemeint sind damit Zeitschriften, die unter Verzicht auf eine Druckversion „genuin“ digitale Publikationsverfahren praktizieren. Der Nutzer (Leser) hat freien Zugriff auf die veröffentlichten Texte und Daten.![]()