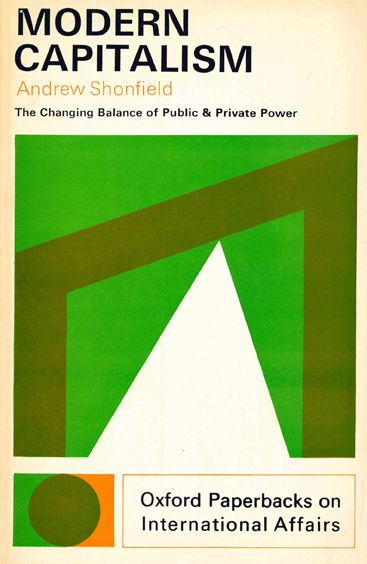Andrew Shonfield, Modern Capitalism. The Changing Balance of Public and Private Power, London/New York: Oxford University Press 1965 (mehrere weitere Ausgaben); dt. Übers.: Geplanter Kapitalismus. Wirtschaftspolitik in Westeuropa und USA. Aus dem Englischen von Margaret Carroux. Mit einem Vorwort von Karl Schiller, Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch 1968. Die Cover-Abbildung zeigt die erste Paperback-Ausgabe von 1969.
»What was it that converted capitalism from the cataclysmic failure which it appeared to be in the 1930s into the great engine of prosperity of the post war Western world?« (S. 3) Das ist die Leitfrage von Andrew Shonfields vor 50 Jahren erschienenem Buch über den »modernen Kapitalismus« der 1960er-Jahre. Wie konnte es zu dem »Goldenen Zeitalter« (Eric Hobsbawm), also der fast drei Jahrzehnte andauernden Nachkriegsprosperität kommen, nachdem der Kapitalismus im Zuge der Großen Depression abgewirtschaftet zu haben schien und sich eine breite ordnungspolitische Debatte um alternative Wirtschaftsformen entwickelt hatte?
Was der britische Ökonom und Journalist Shonfield (1917–1981) allerdings als Antwort auf diese Frage formulierte und als Erfolgsfaktoren des Kapitalismus in den 1960er-Jahren benannte, sah man in den 1970er-Jahren zunehmend kritisch: Die von ihm diagnostizierte Ablösung des Laissez-faire-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts durch wissenschaftlich fundierte Planung und Prognosen, durch Bürokratisierung sowie die immer engere Verflechtung von Staat und Wirtschaft wurde zunehmend mit den Problemen keynesianischer Globalsteuerung identifiziert, die zu Wachstumsschwäche, Inflation und erneuter Arbeitslosigkeit geführt habe. Shonfields These, es sei keineswegs ausgemacht, dass die hohen Wachstumsraten der 1960er-Jahre irgendwann sinken müssten und eine Rückkehr der Konjunkturzyklen zu erwarten sei, wie das zeitgenössisch insbesondere die Ökonomen Simon Kuznets und Arthur Lewis voraussagten, bewahrheitete sich nicht. Wenn er schrieb, angestellte Manager müssten weder sofort auf Entwicklungen des Marktes reagieren noch den maximalen Profit für die shareholder erzielen, dann prognostizierte er die Realität des Kapitalismus unserer Tage offensichtlich falsch. Aber wenn das Buch bald nach seinem Erscheinen bereits überholt war, warum wird es trotzdem weiterhin rezipiert bzw. hat sich in gewisser Weise sogar zu einem wirtschaftssoziologischen Klassiker entwickelt?
Ein Grund dafür dürfte zunächst im empirischen Gehalt des Werkes liegen. Shonfield verglich die Entwicklung in vier entwickelten Volkswirtschaften (Frankreich, Großbritannien, Westdeutschland, USA) seit den 1930er-Jahren äußerst kenntnisreich miteinander und bezog in kürzeren Unterkapiteln auch noch Italien, Österreich und Schweden in seine Betrachtung ein. Hier offenbarte sich ein beeindruckendes Detailwissen, und Shonfield formulierte zahlreiche überraschende Beobachtungen. Unabhängig davon, wie der Leser zu den Thesen des Autors steht: Er lernt auf jeden Fall sehr viel dazu.
Der zweite Grund liegt in der Methode. Im Jahr 2001 machte Peter A. Halls und David Soskices Buch über die »Varieties of Capitalism« Furore, das nach spezifischen regionalen und nationalen Ausprägungen des Kapitalismus fragte.[1] Vieles davon findet sich bereits in Shonfields Darstellung: So erklärte er zum Beispiel das starke Moment der Planung in der französischen Wirtschaft historisch durch die lange Tradition der Staatsintervention seit dem 17. Jahrhundert. Er brachte diese in Verbindung mit dem französischen Ausbildungssystem, das durch seine starke Hierarchisierung bereits frühzeitig die Kontakte herstelle, die später im Wirtschaftsleben wichtig werden sollten. So entsteht das Bild eines spezifisch französischen »Wirtschaftsstils«, der sich vom ostentativen Individualismus der USA, zumindest nach außen hin, stark unterscheide.
Gerade die Betrachtung unterschiedlicher Wirtschaftskulturen begründet überdies die deutliche Kritik am englischen Kapitalismus der 1960er-Jahre, der Shonfield als Brite besonders vertraut war. Ihm zufolge krankte dieser daran, dass einerseits starke Aufmerksamkeit auf die Wirtschaftsplanung gelegt wurde, während andererseits wesentliche Erfolgsfaktoren der französischen »planification« fehlten. Das betraf insbesondere die fehlende Verbundenheit und Vertrautheit von Regierungsmitarbeitern und führenden Industriellen miteinander. Es fehlte eine »Kultur« der Absprache, in der es als vollkommen legitim galt, zentrale Entscheidungen in verrauchten Hinterzimmern auszuhandeln. Hinzu kamen eine ineffiziente politische Organisation der Planung sowie eine starke politische Polarisierung, die Shonfield als Gründe dafür betrachtete, dass Großbritannien seinen am Ende des 19. Jahrhunderts noch so eindeutigen wirtschaftlichen Vorsprung vor Frankreich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg einbüßte.
Drittens wiederum blieb das Buch bei der Beschreibung differierender Wirtschaftskulturen nicht stehen, sondern betonte noch einen anderen wichtigen Punkt: Trotz aller Unterschiede wiesen die entwickelten Industrieländer nach Shonfield klare Gemeinsamkeiten auf. Obwohl insbesondere die Westdeutschen und die Amerikaner offiziell dem ökonomischen Individualismus das Wort redeten, gewann auch hier die Planung zunehmend stärkere Bedeutung – in den USA beispielsweise durch die Herausbildung des Militärisch-Industriellen Komplexes, den Shonfield allerdings explizit als einen Sonderfall behandelte, sowie speziell bei öffentlich finanzierten Infrastrukturmaßnahmen. Zugleich verließen sich die Unternehmen zunehmend auf Expertenwissen. Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung, für Shonfield ein zentrales Merkmal ökonomischer Planung, wurden immer wichtiger. Gerade in der Diagnose der personellen und finanziellen Vernetzung der westdeutschen Vorstände und Aufsichtsräte (wobei den Banken eine wesentliche koordinierende Rolle zukam) war Shonfield ein wesentlicher Stichwortgeber für das, was seit den 1990er-Jahren als »Deutschland AG« bezeichnet wurde.[2]
Es ist gerade diese unter der Oberfläche identifizierbare Konformität der Entwicklung, die einen Blick auf den Kern von Shonfields Argument ermöglicht und zudem einen wichtigen Hinweis darauf gibt, warum er sein Werk »Modern Capitalism« betitelte: Er stellte sich damit in eine Tradition der Analyse des Kapitalismus, zu deren zentralen Aussagen es gehörte, dass dieser überall, wo er sich entwickelte, homogene Verhältnisse schaffe und kulturelle Eigenheiten überforme.[3] Dabei wurde von einer Eigenlogik der wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen, die allerdings keineswegs der neoklassischen Vorstellung selbstinteressierter rationaler Akteure auf effizienten Märkten entsprach. Vielmehr entwickle sich eine institutionelle Gleichförmigkeit, die gerade auf die Anforderungen einer wissensbasierten, technologisch hochentwickelten Produktionsweise reagiere.
Weil technologische Entwicklungsprozesse sowohl lange Zeit in Anspruch nahmen als auch nur in der Zusammenarbeit vieler Menschen und Firmen erfolgreich absolviert werden konnten, gab es für Shonfield keine Alternative zur langfristigen Planung. Zudem war es nur logisch, dass ein Staat, der seine Verantwortung für die Wirtschaft akzeptiert hatte, seine Ressourcen umfassend zur Verfügung stellte, um diese Prozesse zu fördern. Das war es dann auch, was Shonfield in dem bekannten Schlagwort der »Industrial Society« zusammenfasste: dass sich die verschiedenen Teilbereiche der Gesellschaft – Politik, Bildung, Finanzwirtschaft, Industrie – immer enger miteinander verflochten und nicht länger voneinander abgeschottete Sphären bildeten. Ihr produktives Zusammenwirken entschied vielmehr über den ökonomischen Erfolg eines Landes – und genau an dieser Stelle spielten die jeweiligen nationalen Eigenheiten und institutionellen Arrangements eine entscheidende Rolle.
Diese Verflechtung wiederum führte Shonfield dazu, ein gut bekanntes Motiv der Kapitalismusanalyse zu wiederholen: dass die Zeit des liberalen Laissez-faire des 19. Jahrhunderts vorbei sei. Shonfields »Modern Capitalism« wird dominiert von großen Firmen und Firmenkonglomeraten, die aus der Eigenlogik ihrer Organisationen heraus bestimmte Bedürfnisse an rationaler Planung generieren, die der Einzelunternehmer eines Joseph Schumpeter nicht länger befriedigen kann. Das war aber nicht so sehr der Fall wegen eines fortgesetzten Größenwachstums der Firmen aufgrund von Skaleneffekten, wie Schumpeter selbst es in seinem Klassiker »Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie« behauptet hatte.[4] Es ging auch weniger um eine »Vertrustung« der Wirtschaft aufgrund des rent-seekings großer Unternehmen, wie die Ordoliberalen meinten. Vielmehr seien es die strukturellen Erfordernisse einer zunehmend wissensbasierten Wirtschaft, die große Organisationen bevorteilten und zu ihrer Durchsetzung beitrugen.
Es würde Shonfields Arbeit jedoch nicht gerecht werden, sie einfach als Variation dieser klassischen Kapitalismusanalysen zu begreifen. Das zeigt sich schon an der weitgehenden Abwesenheit kulturkritischer Motive, die solche Analysen häufig auszeichneten. Wenn Shonfield beispielsweise die zunehmende geistige Konformität in Großunternehmen als eine wesentliche Voraussetzung für Planung beschrieb, ging er nicht auf die Bürokratiekritik der deutschsprachigen Soziologie ein. Auch William H. Whyte erwähnte er mit keinem Wort, der 1956 diese Konformität kritisch beschrieben und eine Erlahmung des amerikanischen »Capitalist Spirit« befürchtet hatte.[5] Stattdessen wurden derartige Phänomene als Ausdruck einer – durchaus positiv gesehenen – Verwissenschaftlichung der Ökonomie interpretiert. Shonfield antizipierte auch den Veränderungsprozess der Wirtschaft, den Daniel Bell wenige Jahre später wirkungsmächtig als »Post-Industrial Society« beschrieb.[6] Allerdings stand bei ihm weniger der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft im Vordergrund als vielmehr die Feststellung, dass rationale Planung keine geistige Verödung und Preisgabe der Individualität mit sich bringen musste, sondern dass gerade die Apparate den Menschen geistig statt körperlich forderten. Darin steckt viel von Bells Überlegung zur Wissensökonomie, nur eben vor dem Hintergrund einer ganz anderen Vorstellung der Wirtschaft.
Eben mit dieser Vorstellung der industriellen Wirtschaft ist die wohl stärkste These des Buches verbunden, die Shonfield indes kaum ausformulierte, sondern eher »subkutan« vorbrachte: Wenn das Element der Planung und Vorhersage immer wichtiger wird, ist dann nicht langfristig auch eine Konvergenz des kapitalistischen und des sozialistischen Wirtschaftssystems zu erwarten? Shonfield blieb eine Antwort darauf schuldig, schloss sein Buch allerdings mit einer längeren Diskussion der Frage, inwiefern Planung und »Expertokratie« zu einer Diktatur des Sachzwangs führen könnten, wo formale Verfahren und langfristige Planungsprozesse demokratische Entscheidungen verdrängten. Aber auch hier blieb er optimistisch: Durch die Transparenz von Entscheidungsprozessen und demokratisch ausgewählte Kontrollinstanzen könne man solche Gefahren wirksam eindämmen.
Was bleibt von Shonfield heute? Zunächst ist das Werk ein interessantes Zeitdokument, gewissermaßen ein Blick in den Bauch des westlichen Kapitalismus der 1960er-Jahre, nicht nur seiner »Funktionsweise«, sondern auch seiner Selbstwahrnehmung. Schwankte die Analyse des Kapitalismus bis dahin meist zwischen einem übersteigerten Reformismus und larmoyanten Dekadenzdiagnosen, so ist bei Shonfield davon wenig zu finden. Er suchte vielmehr nach genauen Erklärungen für strukturelle Wandlungsprozesse und brachte allgemeine Tendenzen mit der detaillierten Beschreibung der Besonderheiten nationaler Wirtschaftskulturen zusammen. Das steht im Vordergrund, während viele weiterführende Thesen bei ihm eher implizit bleiben. Dieser nüchterne Tonfall kann aber als signifikant für den Zeitgeist der 1960er-Jahre betrachtet werden.
Zudem hat Shonfield viele Dinge auch aus heutiger Perspektive durchaus richtig gesehen. So passen seine Analysen beispielsweise auf die Automobilindustrie, deren Entwicklungs- und Produktionsprozesse in der Zusammenarbeit mit Firmenkonglomeraten geleistet werden und die eng mit Universitäten kooperiert. Ein fast noch besseres Beispiel ist die Produktion von Flugzeugen. Allerdings machte Shonfield auch einen klassischen »Fehler« der Kapitalismusanalyse: Er unterschätzte die Dynamik und Unberechenbarkeit des technischen Wandels. So kamen beispielsweise im Bereich der Computertechnologie wichtige Innovationen gerade nicht aus den großen Forschungslaboren. Davon, dass neue Formen der Logistik zur räumlichen Verlagerung ganzer Industrien führen können, findet sich in dem Buch nichts. Aber letztlich lässt sich die Unterschätzung des technischen Wandels schon bei Karl Marx beobachten, und damit ist Shonfield ja in guter Gesellschaft.
Gerade die Tatsache, dass Shonfields Prognosen, aufs Ganze gesehen, nicht eingetreten sind, kann zu einem grundsätzlichen Nachdenken über die wissenschaftliche Kapitalismusanalyse anregen. Shonfield hatte schließlich gute Gründe, den »modernen« Kapitalismus so zu analysieren, seine Entwicklungsdynamik so zu extrapolieren, wie er es getan hat. Woran er letztlich »scheiterte«, war nicht seine analytische Schwäche, sondern die außergewöhnliche Entwicklungsdynamik des Kapitalismus selbst, die sich eben nicht so einfach ausrechnen und vorhersehen lässt. Ließe sich das verallgemeinern, dann wäre Shonfields Werk geradezu eine Mahnung an die heutige Kapitalismusanalyse und -kritik (die im Übrigen in den seltensten Fällen an die empirische Tiefe seiner Analysen heranreicht): Ist es beispielsweise angesichts der genannten Entwicklungsdynamik wirklich sinnvoll, sich die Frage nach dem Prognosewert soziologischer Klassiker zu stellen, in der Hoffnung, mit den von Karl Marx oder Max Weber bereitgestellten theoretischen Zangen das heutige Wirtschaftsleben empirisch immer noch greifen zu können? Geht es wirklich tief genug, Wandlungsprozesse des Kapitalismus auf der Ebene der Semantiken, seines »Geistes« zu verorten, wie Luc Boltanski und Ève Chiapello gemeint haben?[7]
Andrew Shonfield konnte in den 1960er-Jahren noch einen Kapitalismus beschreiben, dessen Funktionsweise sich von der Dynamik des einzelwirtschaftlichen Wettbewerbs weitgehend emanzipiert hatte; eine Beschreibung, die nicht zuletzt angesichts der Strukturkrisen der 1970er-Jahre an Plausibilität verlor. Wenn heute von »Vermarktlichung« und »Finanzialisierung« gesprochen wird – und damit letztlich gegenteilige Diagnosen gestellt werden –, so kann Shonfields Werk zumindest zur Vorsicht anhalten, sich der historischen Begrenztheit solcher Entwicklungsprognosen bewusst zu sein. Anders formuliert: In ihnen ist nicht das »Ende der Geschichte« beschlossen, sondern technische Entwicklungen oder Strukturkrisen können auch hier dazu führen, dass sich historisch wieder etwas ganz Neues entwickelt. Insofern liegt das eigentliche Wesensmerkmal des Kapitalismus in seiner Veränderungsdynamik, und gerade der Abstand von 50 Jahren macht dies beim Wiederlesen von Shonfields »Modern Capitalism« mehr als deutlich.
Anmerkungen:
[1] Peter A. Hall/David Soskice, Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford 2001.
[2] Siehe dazu Ralf Ahrens/Boris Gehlen/Alfred Reckendrees, Die Deutschland AG als historischer Forschungsgegenstand, in: dies. (Hg.), Die »Deutschland AG«. Historische Annäherungen an den bundesdeutschen Kapitalismus, Essen 2013, S. 7-28.
[3] Vgl. dazu Roman Köster, Transformationen der Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik in Deutschland im 20. Jahrhundert, in: Werner Abelshauser/David A. Gilgen/Andreas Leutzsch (Hg.), Kulturen der Weltwirtschaft, Göttingen 2012, S. 284-303, bes. S. 288f.
[4] Joseph A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1946.
[5] William H. Whyte, The Organization Man, New York 1956.
[6] Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York 1973.
[7] Luc Boltanski/Ève Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003.