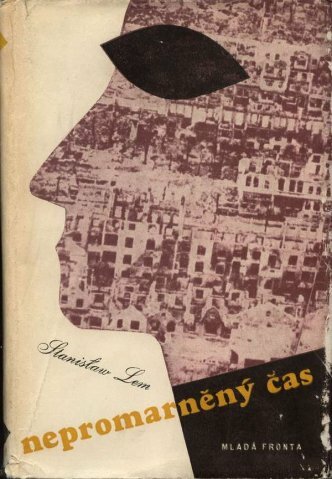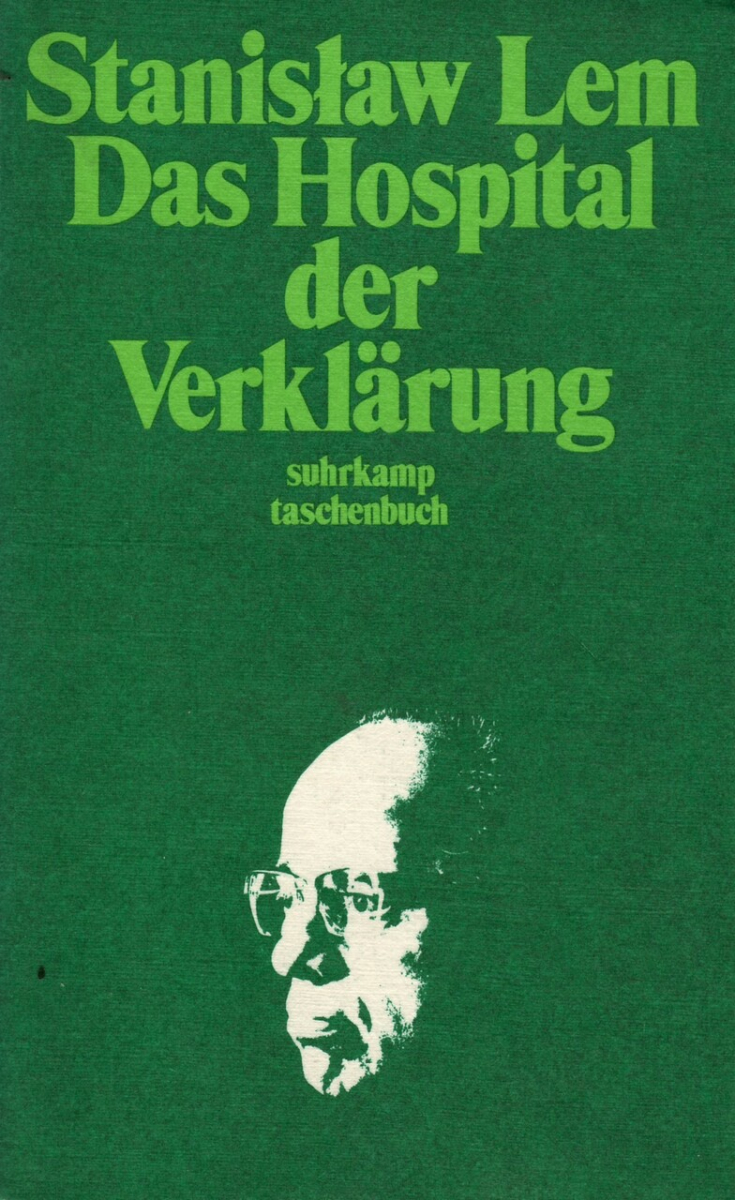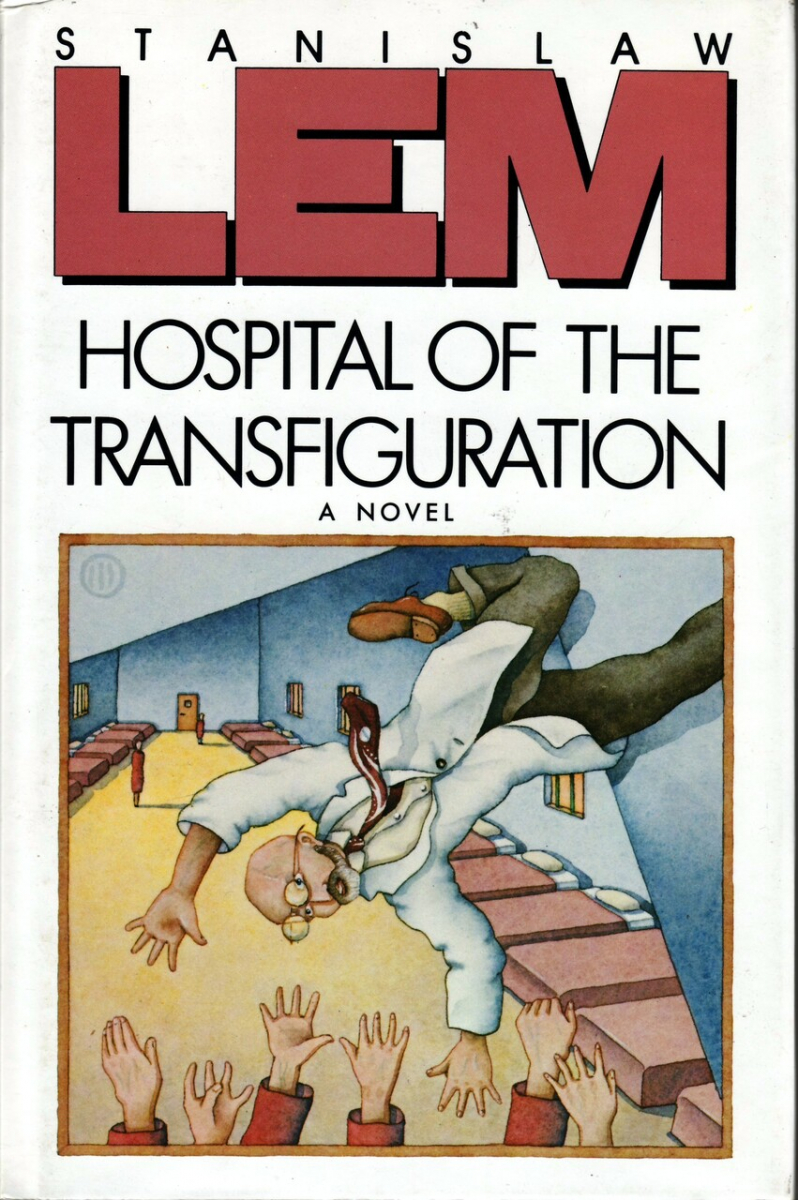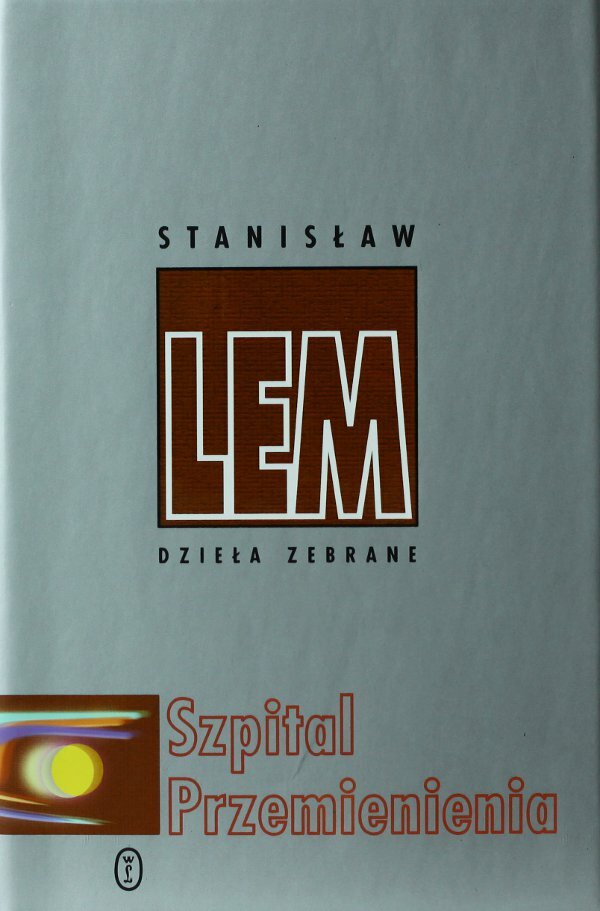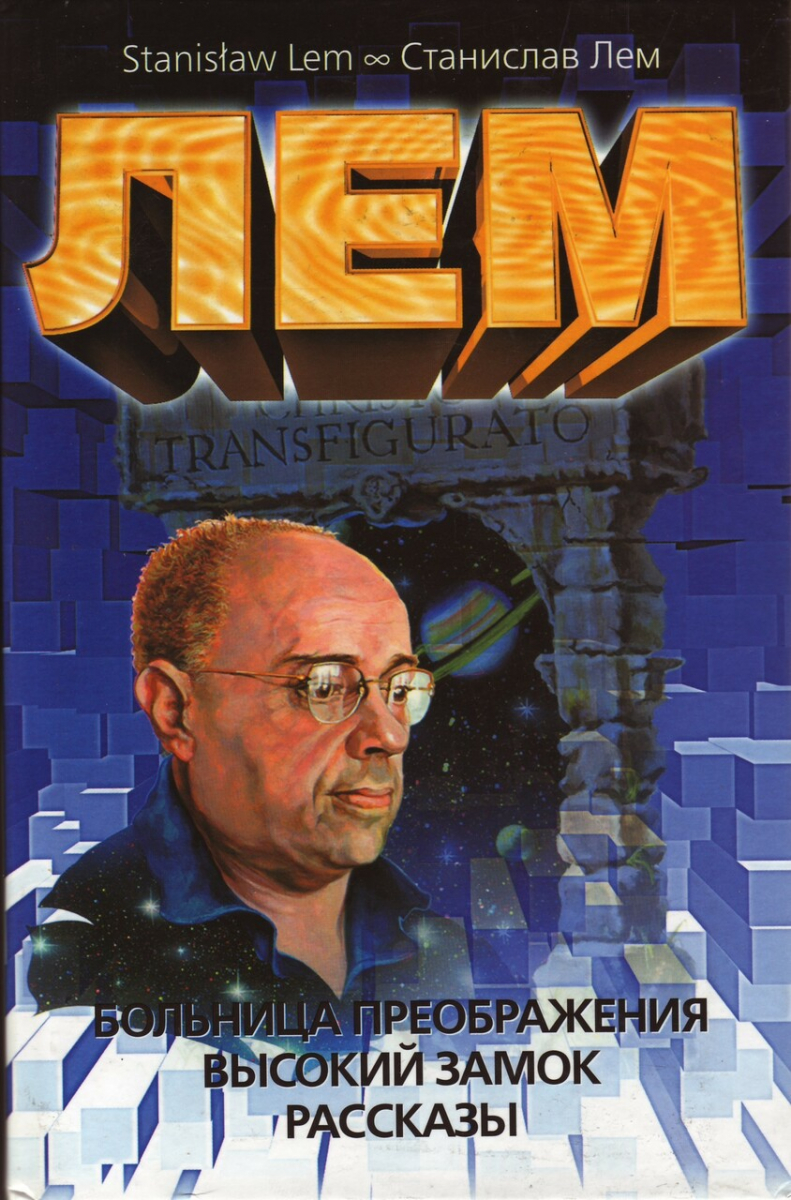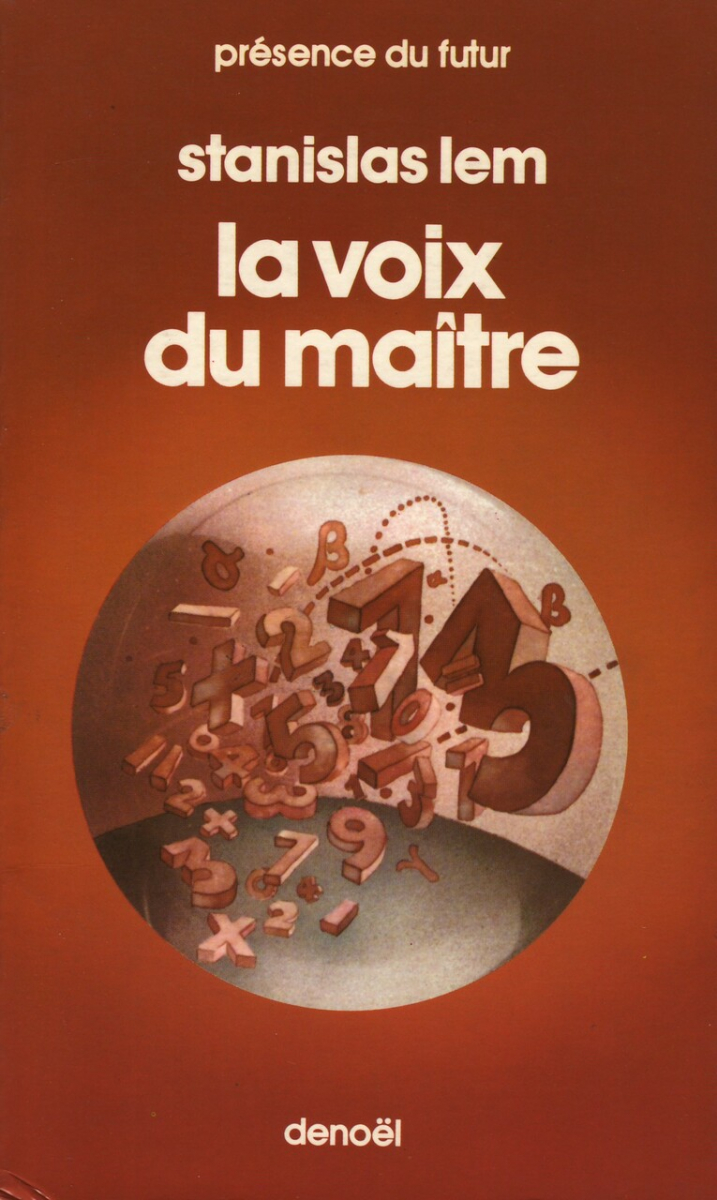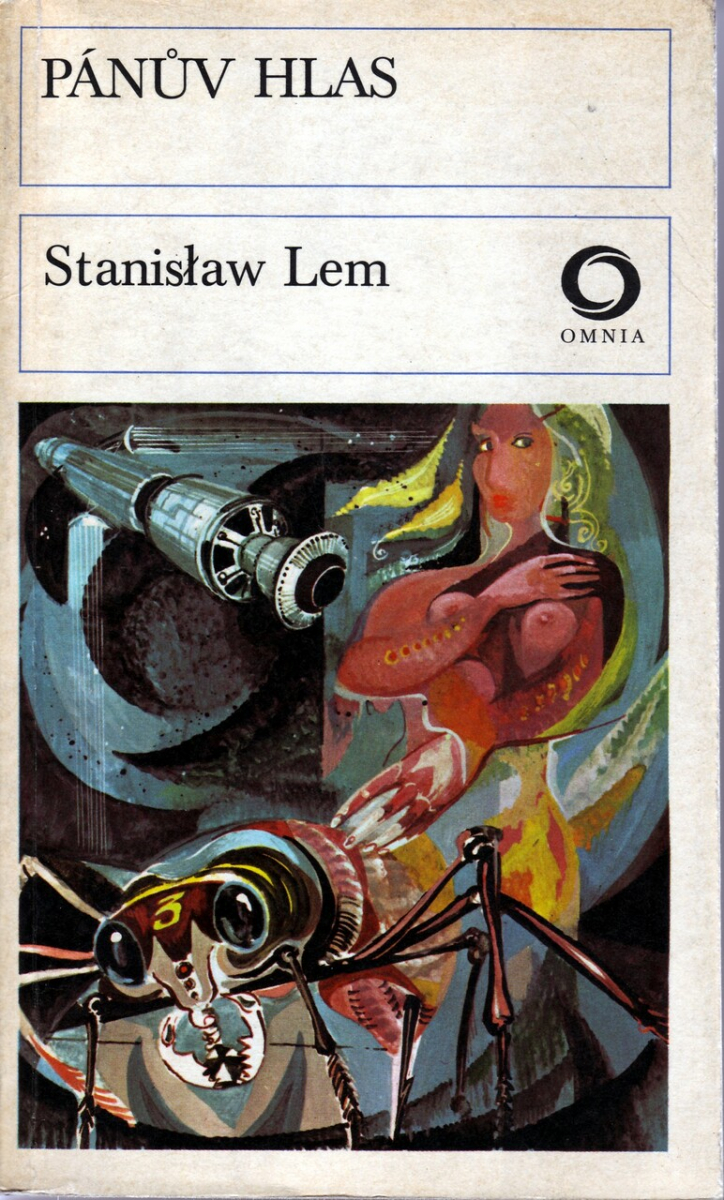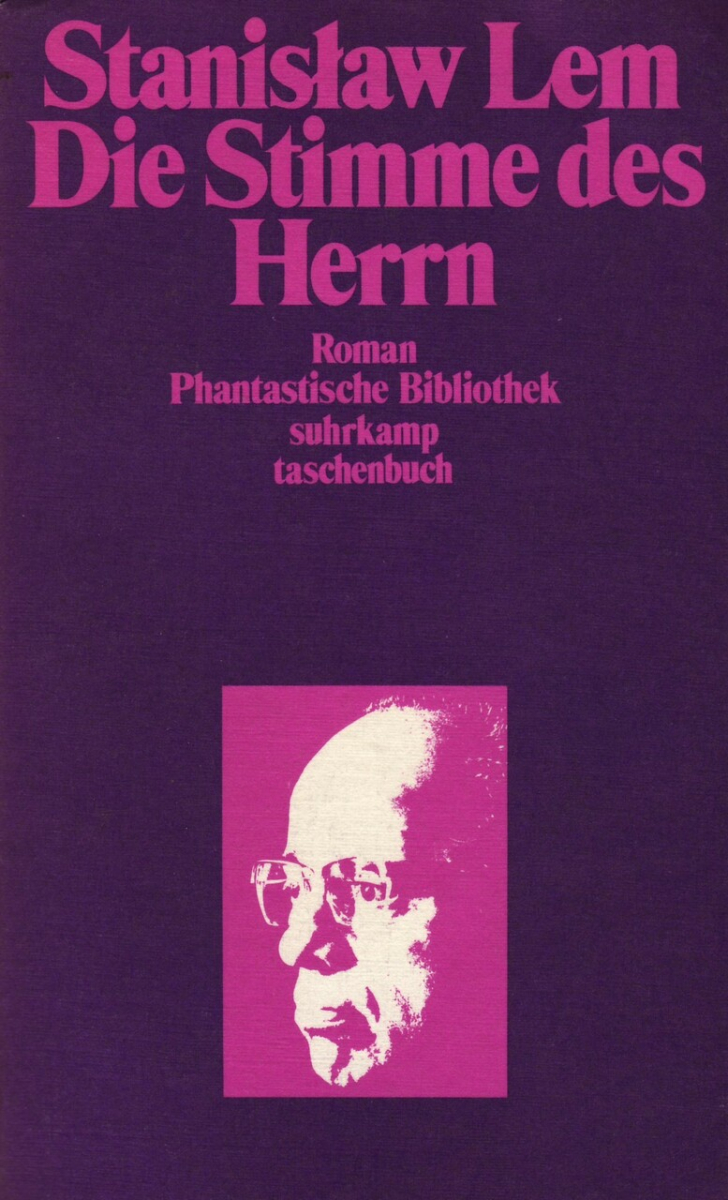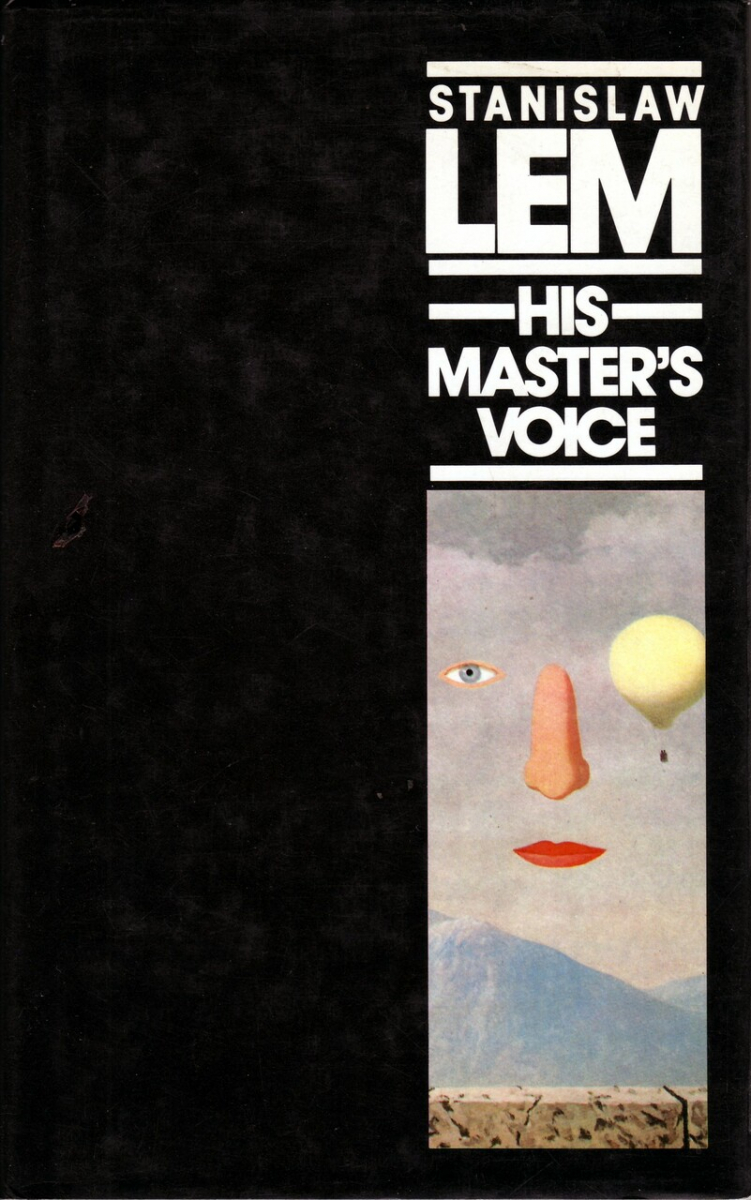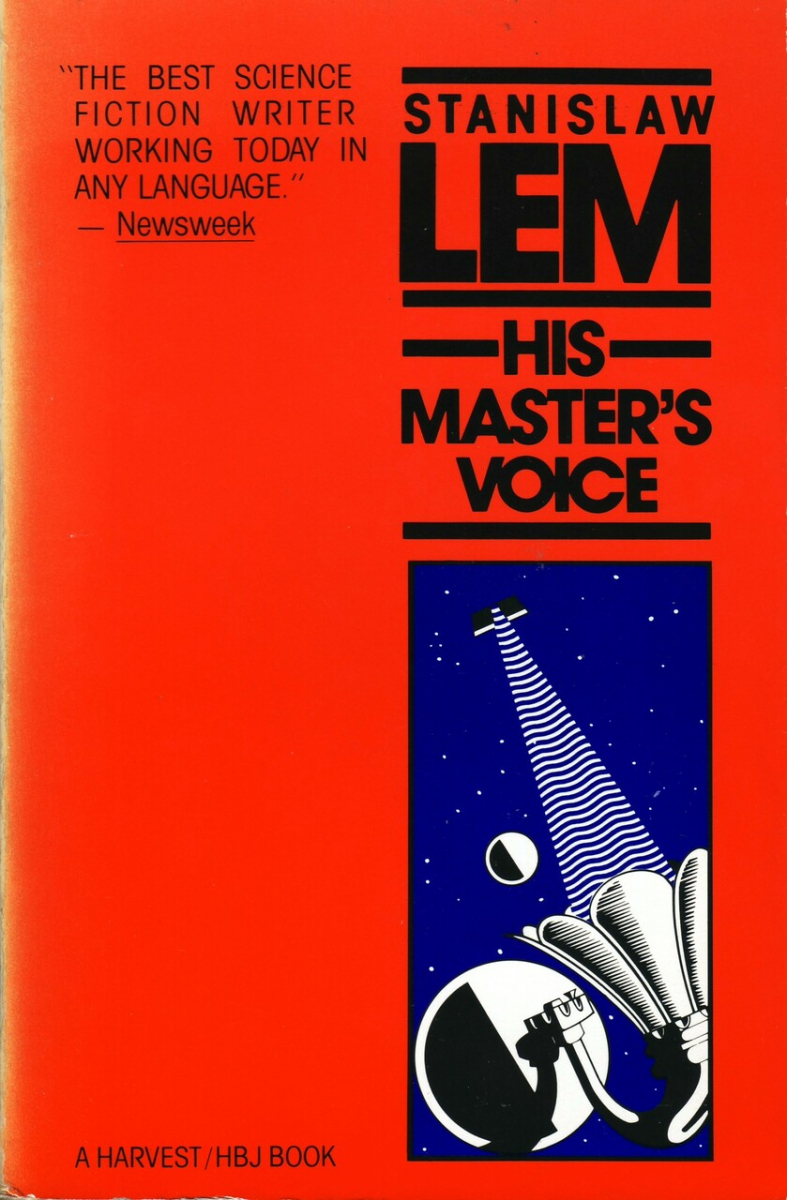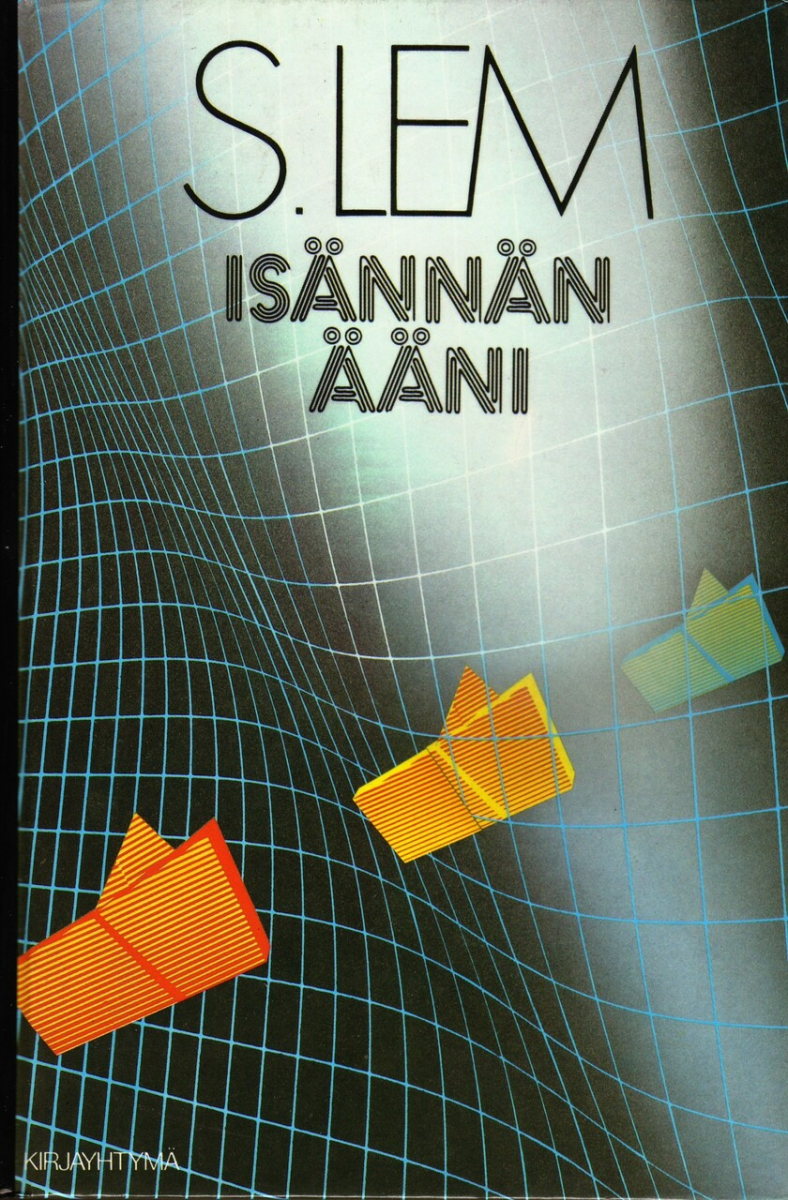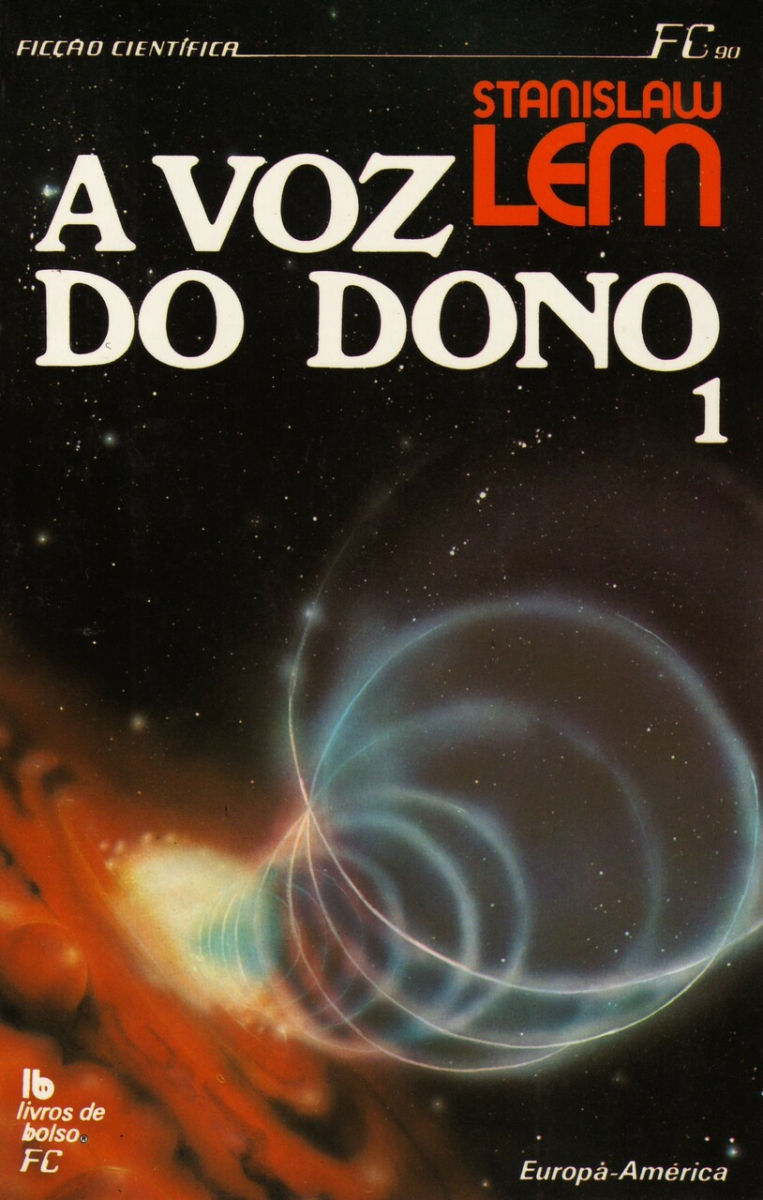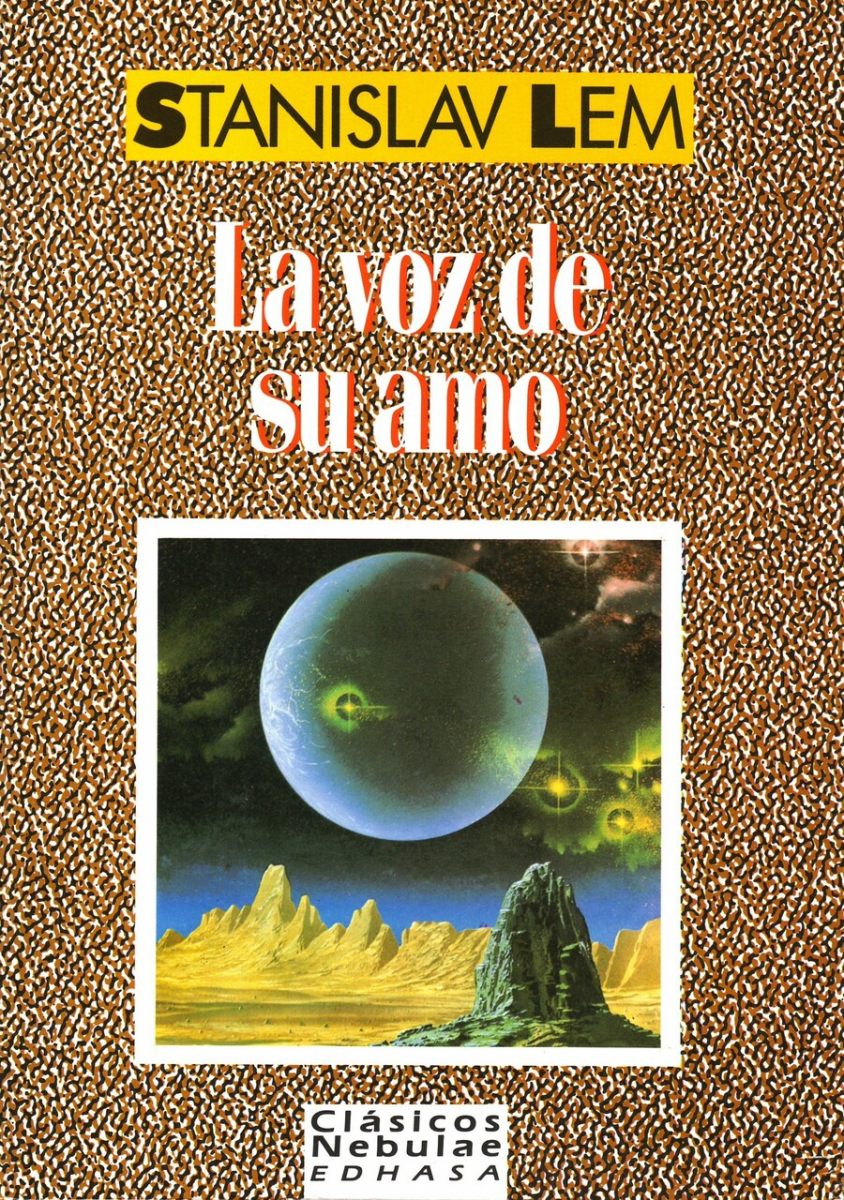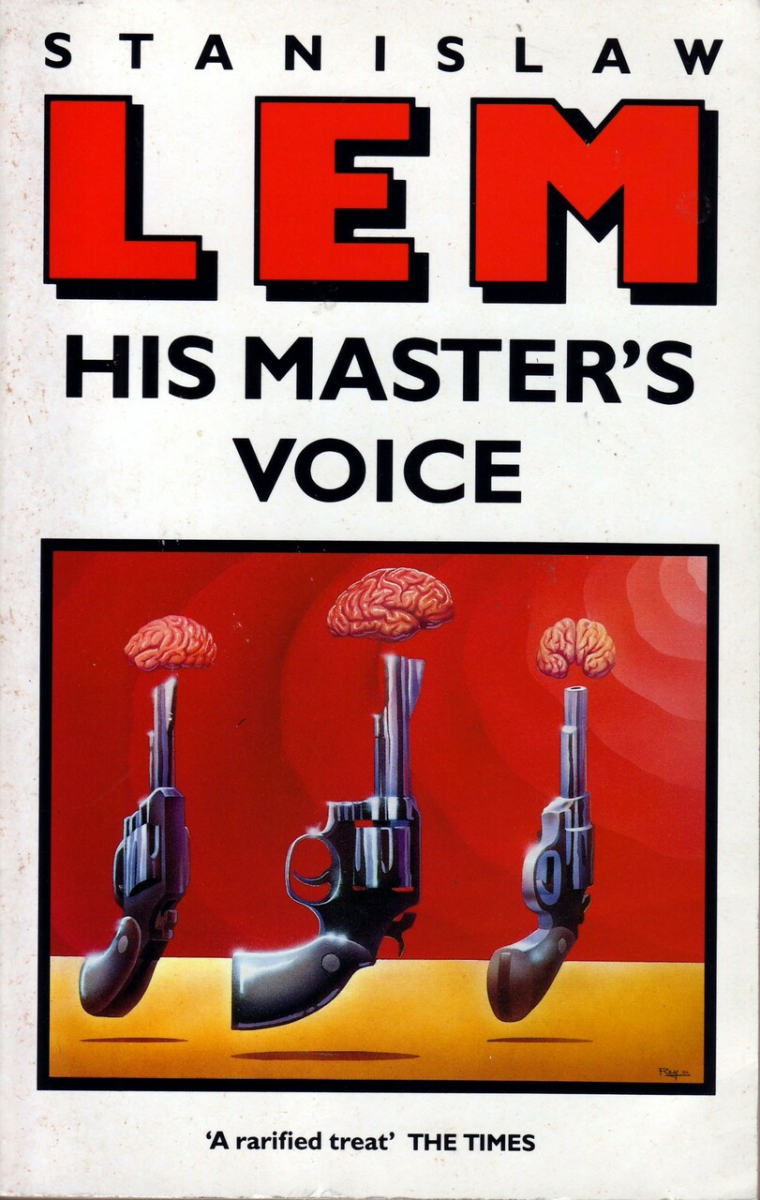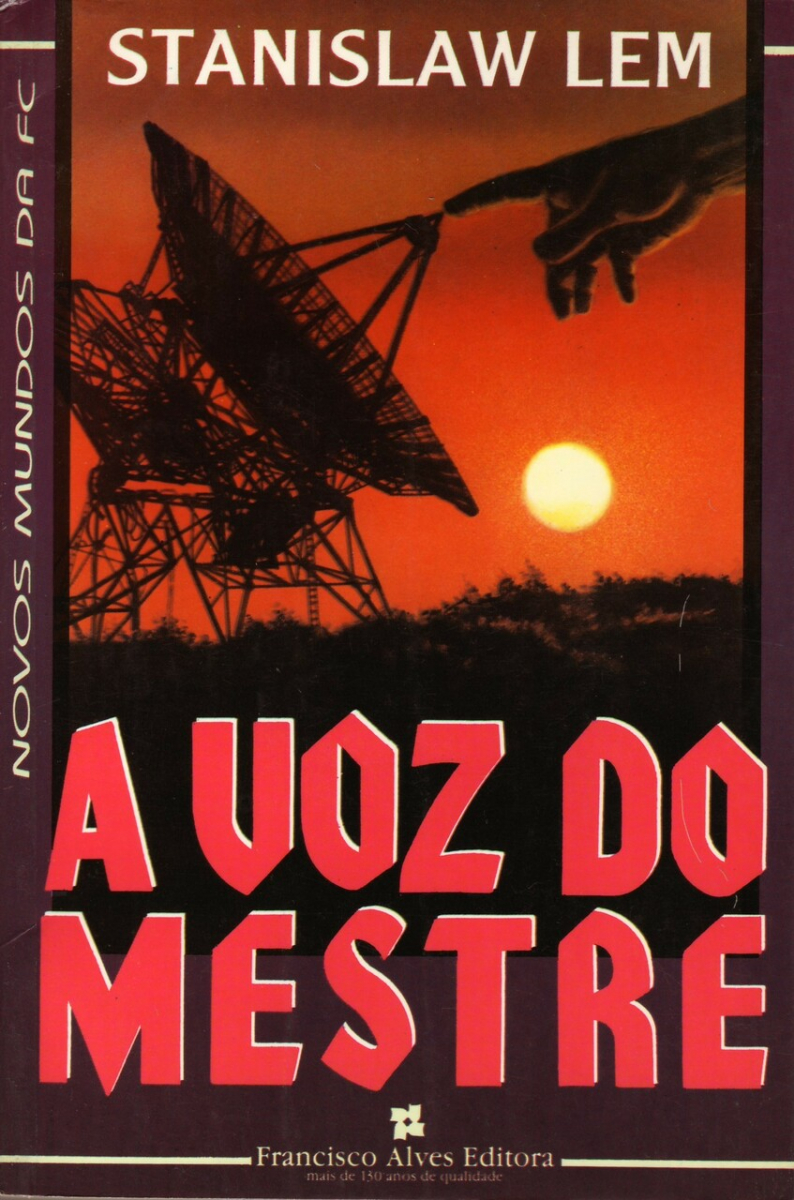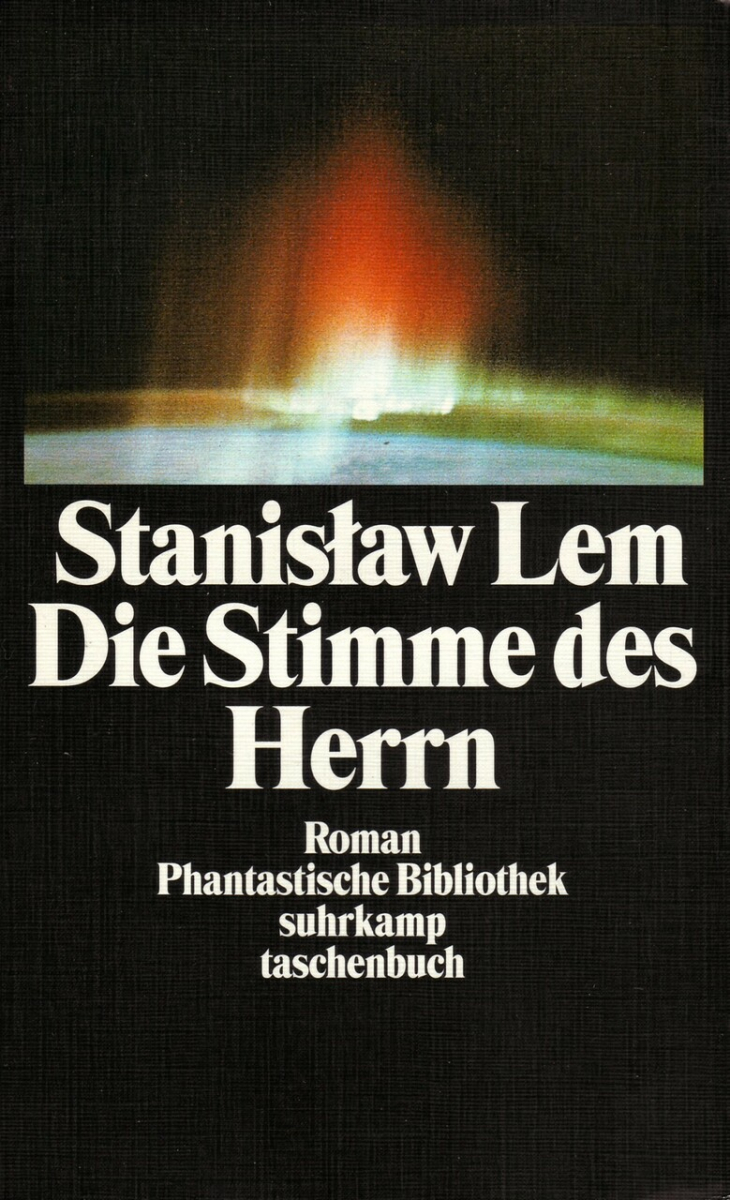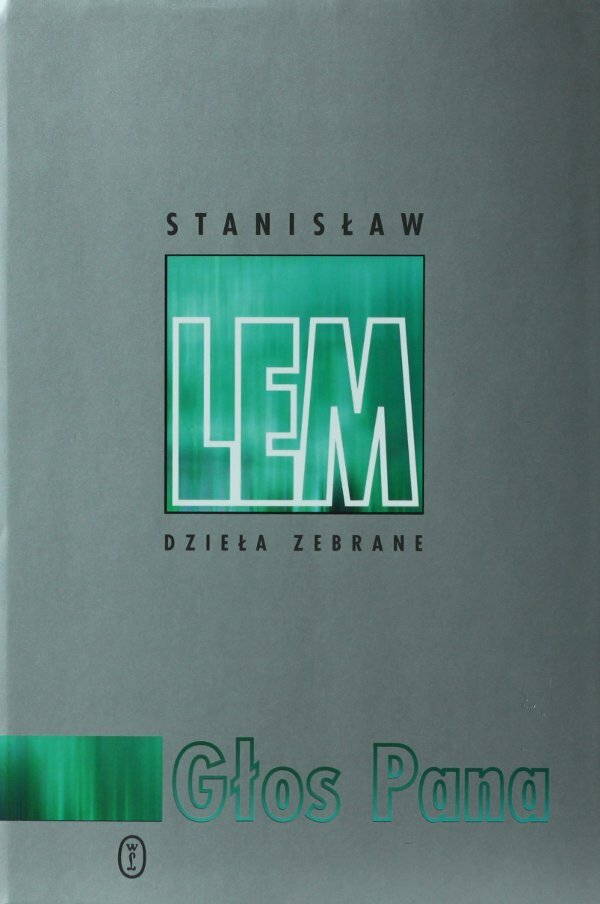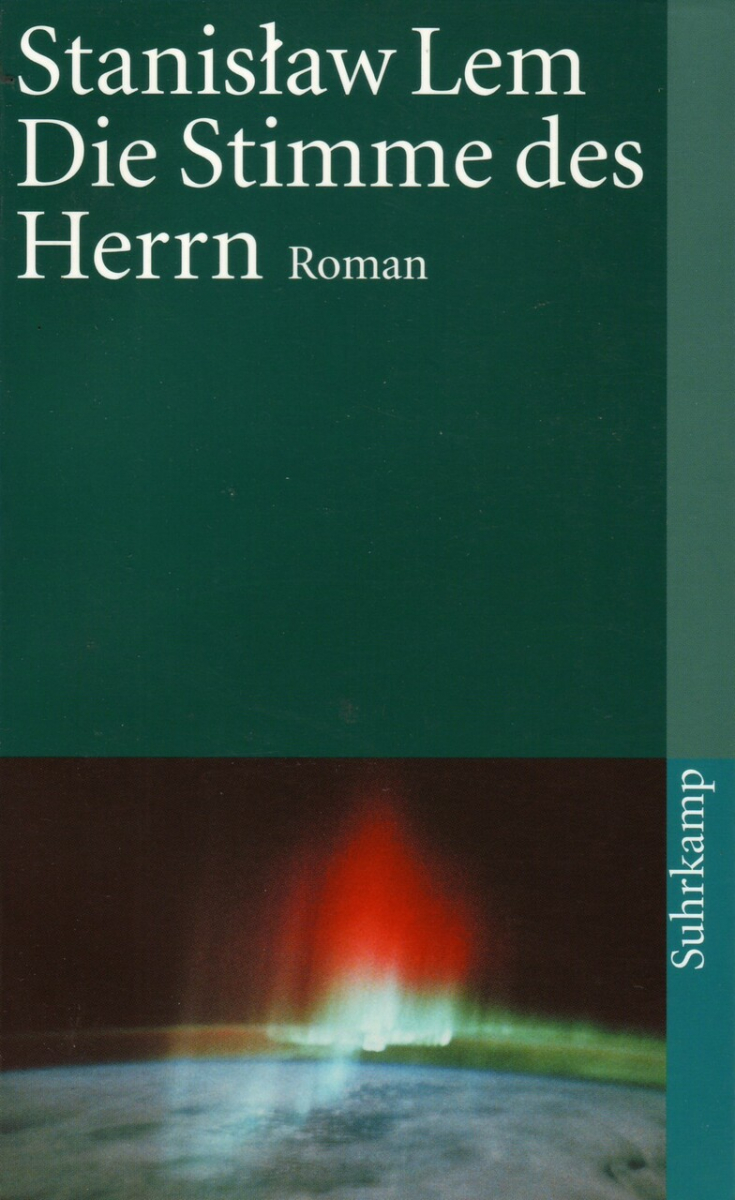Zeit seines Lebens hat sich Stanisław Lem (1921–2006) dagegen verwehrt, Science-Fiction-Autor genannt zu werden. Natürlich war er selbst an dieser Etikettierung nicht ganz schuldlos, denn wer einen Großteil seiner literarischen Sujets in außerirdische Welten verlagert, von denen »Robotermärchen« und »Sterntagebücher« künden, dem mag es leicht passieren, dass er im Regal des Buchladens neben Perry Rhodan landet. Doch hat Lem nicht allein futuristische Szenerien entworfen. Sein erster Roman »Das Hospital der Verklärung« war ein überaus realistisches Werk, noch dazu mit dem Blick in einen historischen Abgrund: Beschrieben wird die Konfrontation eines jungen polnischen Arztes mit dem Patientenmord an den Bewohner*innen einer Nervenheilanstalt während des Zweiten Weltkrieges durch die deutschen Besatzungstruppen. Dieser Erstling ist hinter den Spiralnebeln der späteren Bestseller des Autors lange Zeit weitgehend verborgen geblieben. Doch ist die Darstellung nicht allein aufgrund ihrer literarischen Qualität bedeutsam, sondern stellt, 1948 geschrieben, eine der ersten intellektuellen Reflexionen des nationalsozialistischen Krankenmordes dar. Vor allem trägt der Text zur Erhellung einer wesentlichen biographischen Dimension von Stanisław Lem bei: seiner eigenen und familiären Erfahrung von Gewaltherrschaft und Besatzungszeit.
Dieser Beitrag folgt der Spur, die die persönlichen Erlebnisse zuweilen als Leitmotiv, zuweilen als irrlichternder Splitter im Kosmos von Lems Werks hinterlassen haben. Hierzu gehören nicht nur seine Romane, sondern auch einige Einleitungen und Rezensionen zu real existierenden und – Lems besonderes Markenzeichen – zu einigen nicht existenten Büchern.1 Die Erfahrung schicksalhaften Leids, so ist zu zeigen, erwies sich als prägend für Lems lebenslange Beschäftigung mit dem »Zufall« als maßgeblicher Konstante des Seins und bestimmte auch die überaus ernsthaften Ansprüche, die er an das von ihm generell als trivial eingestufte Genre der Science Fiction stellte.
Stanisław Lem ist durch die populären Welten von »Solaris« oder die skurrilen Abenteuer des Raumpiloten Ijon Tichy – eines »Schwejk als Weltraumfahrer«, wie Siegfried Lenz ihn nannte2 – auch im Blick seines Lesepublikums derart in futuristische Sphären entrückt, dass leicht in Vergessenheit gerät, in welcher realen Zeit und Umgebung der Schriftsteller lebte. In der Tat verbrachte Lem seine Jugend in den »Bloodlands« Europas zwischen Hitler und Stalin,3 mit einem raschen Wechsel politischer Verhältnisse und einfallender Besatzer. Hier erlebte Lem »das arme, aber unabhängige« Vorkriegspolen, »die Pax Sovietica in den Jahren 1939–1941, die deutsche Besatzung, das zweite Kommen der Roten Armee, die Nachkriegsjahre in einem völlig anderen Polen«.4
Zu den zahlreichen Schrecken der deutschen Invasion und Herrschaft in dieser Zeit gehörte die Ermordung der Bewohner*innen von Nervenheilanstalten – teils durch Erschießungsaktionen, teils durch Verhungernlassen. In Lems Heimatstadt Lemberg war damals die traditionsreiche Einrichtung in Kulparkow, einem nahegelegenen Dorf, für die Pflege von Geisteskranken zuständig. Mit vier anderen Orten gehörte sie zu den Kliniken in der Region, die Schauplatz grausamer Patientenmorde wurden.5 Vermutlich waren es die Geschehnisse in ebendiesem Kulparkow, die Lem als Vorlage für seinen ersten Roman dienten: »Das Hospital der Verklärung« erzählt die Geschichte eines jungen Arztes, der durch Zufall den Dienst in einer Nervenheilanstalt während des Zweiten Weltkrieges aufnimmt und sich zunehmend in die eigentümliche Welt dieser Anstalt einfindet: Einzelne Charaktere innerhalb der Ärzteschaft werden ebenso gezeichnet wie verschiedene Porträts der Bewohner*innen mit ihren persönlichen und pathologischen Eigenheiten.
Das Schlusskapitel schildert die Massenerschießung der wehrlosen Insassen des Heims durch die einfallende SS – auch die Belegschaft des Krankenhauses zerschellt weitgehend an dieser moralischen Klippe. Während sich allein der Klinikdirektor den Deutschen mutig entgegenstellt und vergeblich Kranke zu verstecken sucht, verzichtet der deutsche Chirurg – eine Kapazität seines Faches – darauf, sein Renommee zugunsten der Bedrohten zu verwenden. »Er wisse von nichts und wolle sich auch in nichts einmischen.« (S. 148) Als erbärmlichste Gestalt wirkt jedoch der Wissenschaftler Dr. Marglewski, der unter dem Vorwand, seine medizinhistorische Forschung über gesundheitliche Leiden von Genies – »Dante – Schizoider, Goethe – Alkoholiker…« – zu retten, heimlich die Anstalt verlässt. Wie sich Marglewski »zum Tor hinausschlich, beladen mit zwei schweren Koffern und einem Rucksack, der vollgestopft war mit den Karteikarten zu seiner Arbeit über die Genies«, gehört wohl zu den trefflichsten literarischen Sinnbildern über das Versagen der abendländischen Kultur und ihrer intellektuellen Eliten im Angesicht der heraufziehenden Barbarei (S. 242). Zurück bleiben das Peitschen der Gewehrschüsse, »das Heulen der Wahnsinnigen und die heiseren Stimmen der SS-Leute«; »es währte lange« (S. 256f.).
Lem betonte, dass es die geschilderten Personen nie gegeben habe, die Erzählung gleichwohl seine »Erfahrungen aus der Zeit des Krieges und der Okkupation« spiegele (Vorwort, S. 7-9). Als Motiv, weshalb er diesen »realistischen Roman« verfasst habe, nannte Lem die Absicht, sich gewissermaßen »von dem Gewicht der Erinnerung zu befreien«, zugleich aber »auch, um nicht zu vergessen: das eine konnte ja durchaus mit dem anderen einhergehen«.6 Lem beklagte im Vorwort der bundesdeutschen Erstausgabe, dass der Roman erst 1955 in Polen erscheinen konnte, da er dem sozialistischen Realismus nicht entsprach.7
Subtil legt Lem die Assoziation mit einem anderen großen Werk der Weltliteratur nahe: Thomas Manns »Zauberberg«, den der junge Arzt im Roman aus einem Regal der Anstaltsbibliothek zieht, fungiert als böser Spiegel der Ereignisse. Während die von Mann beschriebene dekadent-tuberkulöse Oberschicht im luxuriösen Davoser Sanatorium das Grollen des heraufziehenden Ersten Weltkrieges kaum vernimmt, weil sie sich in selbstgewählter Weltflucht gefällt, befinden sich die Patient*innen in Kulparkow als völlig wehrlose Opfer im Zentrum der Massaker der zweiten weltumspannenden Kriegskatastrophe des 20. Jahrhunderts.8 Zudem schildert Lem nicht nur das drohende Herannahen des Kriegsgeschehens, sondern auch die verbrecherischen Menschenversuche durch einen deutschen Anstaltsarzt. Den realistischen Schrecken gewinnt die Szene auch aus ihrer anatomischen Detailliertheit. Denn wie sein Vater war Stanisław Lem studierter Mediziner; seine erste Lektüre als Kind waren laut eigener Schilderung die anatomischen Atlanten des Vaters.9 Dessen Lebensweg, aber auch seine eigenen frühen Erlebnisse unter deutscher Besatzungsherrschaft brachten ihn auf eines seiner Lebensthemen, den »Zufall«.
»Als im Jahr 1915 die Festung Przemysl fiel, wurde mein Vater als Arzt der Österreichisch-ungarischen Armee von den Russen gefangengenommen. Nach fast fünf Jahren ist er durch das Chaos der russischen Revolution in seine Heimatstadt Lemberg (Lwow) zurückgekehrt, und ich weiß aus seinen Erzählungen, daß er zumindest einmal von den Roten als Offizier, also als Klassenfeind, auf der Stelle erschossen werden sollte und nur deswegen mit dem Leben davonkam, weil ihn, als er bereits zur Erschießung geführt wurde, vom Gehsteig einer ukrainischen Kleinstadt ein Mann bemerkte und erkannte – ein jüdischer Friseur aus Lemberg, der den Stadtkommandanten höchstpersönlich rasierte, so daß er freien Zutritt zu ihm hatte. Deswegen hat man meinen Vater, der ja damals noch nicht mein Vater war, freigelassen, und er kehrte nach Lemberg zu seiner Verlobten zurück.« Hier spielte also »der Zufall das Schicksal in Person«, denn »wäre dieser Friseur nur eine Minute später durch diese Gasse gegangen, hätte es für meinen Vater keine Rettung gegeben« – und es hätte ihn selbst, Stanisław Lem, nie gegeben.10
Doch auch der Autor selbst entging nur knapp dem Unheil. So hatte er während seiner Jugend im besetzten Lemberg als Hilfsarbeiter Zugang zum sogenannten »Beutepark« der deutschen Luftwaffe. Hieraus Munition zu entwenden und »irgendeinem Unbekannten zu übergeben, von dem ich nur wußte, daß er in der Widerstandsbewegung tätig war«, habe er damals für seine »Pflicht« gehalten.11 Zu den dramatischsten Erfahrungen gehörte, wie sein Sohn Tomasz Lem kürzlich in Erinnerungen preisgab, dass sein Vater unter Aufsicht der Deutschen verwesende Leichen aus einem Keller mit Häftlingen tragen musste, die von den sich zurückziehenden Sowjets erschossen worden waren.12 Zudem transportierte Stanisław Lem heimlich Waffen für den polnischen Untergrund, was ihm bei einer Trambahnfahrt fast zum Verhängnis wurde: »Einmal sprang ein so genannter ›Schwarzer‹, ein ukrainischer Polizist, von hinten auf dasselbe Trittbrett und umarmte mich, um sich an den Türgriffen festzuhalten, was für mich ein schlechtes Ende hätte bedeuten können.«13 Diese Erlebnisse, so resümiert Lem, begründeten es, »daß es kein Zufall ist, welche Rolle ich dem Zufall als Gestalter des Schicksals in meinem Werk beigemessen habe« – Überlegungen, die der Autor etwa in eine zweibändige »Philosophie des Zufalls« münden ließ.14
Erst spät äußerte sich Lem öffentlich über das ihm zugefügte Leid. In seiner Jugendautobiographie »Das Hohe Schloß«15 fehlt noch jeder Verweis auf seine jüdische Herkunft. Seit der Intensivierung der Holocaust-Forschung und ihrer öffentlichen Rezeption in den 1980er-Jahren berichtete Lem dann vereinzelt über seine Erfahrungen: Dass die Deutschen »außer Vater und Mutter meine ganze Familie ermordet haben«, erfuhren die bundesdeutschen Leser*innen 1986, als Lem die Einleitung zu Władysław Bartoszewskis Textsammlung »Aus der Geschichte lernen?« verfasste.16 Bereits zur Neuausgabe von Bartoszewskis Buch »Das Warschauer Ghetto – wie es wirklich war« hatte Lem 1983 das Vorwort geschrieben. Hier war auch einer der wenigen Momente, in denen er seine historische Erfahrung direkt in eine Kontroverse einbrachte: Hintergrund war ein Streit mit dem Philosophen Paul Feyerabend über die Frage, wie sich Menschen im Angesicht ihres Untergangs verhielten. Feyerabend hatte Lem mangelnde Kenntnis unterstellt (»der gute Herr hat keine Ahnung von der Vielfalt der menschlichen Reaktionen«).17 Lem konterte mit seinen Anschauungen im Lemberger Ghetto im Jahr 1942: »Obwohl kein Fachethnologe, habe ich das Verhalten der Juden im Ghetto – immerhin wurden in jenem Herbst etwa 180.000 umgebracht, also mehr [Menschen] als in ganz Hiroshima – dicht vor der Massenexekution beobachten können.«18 Das Verhalten von Todgeweihten war tatsächlich ein Thema, das Lem bereits in seiner »Philosophie des Zufalls« erörtert hatte: Dort schilderte er einige auf den ersten Blick absonderlich erscheinende Handlungsweisen, die er im Lemberger Ghetto wahrgenommen hatte, und resümierte: Dies alles sei nur nachvollziehbar für diejenigen, die auch die »extremen Bedingungen« erfahren hätten. »Dort wo man die Methoden der deutschen Besatzung weder erlebt noch aus der Nähe beobachtet hat, könnten Beschreibungen derartiger Ereignisse für eine gespenstische Phantasie gehalten werden, in der die menschliche Natur karikaturhaft entstellt wird, vielleicht um sie zu verhöhnen oder widerwärtig erscheinen zu lassen.«19
Es waren diese persönlichen »Durchgänge durch ein Katastrophengebiet«,20 die für Lem offenbar etwas Grundlegendes bewirkten: seine Sicht auf die Futurologie und die intellektuellen Möglichkeiten, die sich in diesem nach der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch weitgehend »bücherleeren Raum« eröffneten.21 Unlängst hat der Kulturhistoriker Matthias Schwartz dementsprechend die Vermutung geäußert, dass immer dann, wenn es in Lems »fiktionalen Gedankenexperimenten um das absolut Andere, Unverständliche fremder Lebensformen und das Grauen geht, das diese beim und im Menschen erwecken, die traumatische biographische Erfahrung deutscher Besatzungsherrschaft« fortlebe.22 Dieses Argument lässt sich bekräftigen und vertiefen, bezieht man mit ein, was Lem über das Werk eines Pioniers der Science Fiction geschrieben hat: H.G. Wells und seinen »Krieg der Welten«.
Aus Lems Sicht lag die einzig erstrebenswerte Paradigmatik der Science Fiction in einer »Weiterentwicklung derjenigen Ausgangspositionen«, die H.G. Wells im Jahr 1898 mit seinem Roman »The War of the Worlds« errichtet hatte. »Er ist ja diesen ersten Feldherrnhügel hinaufgestiegen, von dem aus man die Gattung in einer Extremlage beobachten kann. Er hat ein Katastrophengebiet vorausgesehen, und zwar richtig: ich habe das im Krieg feststellen können, als ich den Roman etliche Male las.«23 Im Nachwort der polnischen Ausgabe von »Krieg der Welten« führte Lem 1974 näher aus, weshalb dieses Buch, »mit dem die Genealogie der Science-Fiction beginnt, noch immer unerreicht ist«. Denn der Zweite Weltkrieg habe das Werk »durch eine neue, grausame Bedeutung aktualisiert«.24 Menschen aus seiner Generation würden sich, »gerade in diesem so schrecklich heimgesuchten Lande«, daran erinnern, »wie wenige Bücher es damals gab, die man lesen konnte, ohne unwillig zu werden« angesichts der realen Kenntnis der »Mechanismen der Zerschlagung einer Kultur«. Und dabei sei es unerheblich gewesen, dass »das, was uns zu zermalmen drohte, eine Invasion von Menschen war, die von einer Doktrin des Völkermords getrieben waren, während eine Vernichtungspolitik desselben Umfangs in Wells’ Roman auf eine erfundene Invasion vom Mars zurückgeht«.25 Gerade »diejenigen, die wie ich den Krieg in der modernen, vom Faschismus erfundenen Form des totalen Krieges erlebt haben, der auf die vollständige Vernichtung der Besiegten ausgeht, erkennen in diesem ›phantastischen‹ Werk die unvergeßlichen Bilder der chaotischen Massenflucht, des Zerfalls der gesellschaftlichen Bindungen wieder, erkennen die Schnelligkeit, mit der der gesamte Ablauf des Lebens, all die traditionellen Gebräuche, all das, was wir als natürliches Menschenrecht betrachten, zu Staub« zerfiel.26 Im Angesicht von Holocaust und Zweitem Weltkrieg, die »alle bisherigen literarisch erprobten narrativen Konventionen zermalmt und zersprengt« hatten, wandte sich Lem der Science Fiction zu, »weil sie sich mit der Gattung Mensch (oder gar: mit den möglichen Gattungen vernünftiger Wesen, von denen eine der Mensch ist)« befasste.27
Das »Böse« im Menschen, kriegerische Auseinandersetzungen und Tyrannei blieben in vielerlei Gewand das Kernthema des Autors. Ein weniger populäres Werk nimmt hierbei eine Schlüsselstellung ein: »Die Stimme des Herrn« , in Polen zuerst 1968 sowie in der Bundesrepublik und in der DDR erstmals 1981 erschienen. Der Protagonist, der Mathematiker Peter Hogarth, ist unschwer als Alter Ego des Schriftstellers erkennbar. Die Menschheit erhält in diesem Roman ein außerirdisches Signal, und Lem spielt die Konsequenzen durch: Wissenschaftler verschiedener Disziplinen sprechen sich gegenseitig die Deutungsmacht ab – am Ende wird aus Informationsbruchstücken der himmlischen Botschaft eine neue Massenvernichtungswaffe hergestellt. Die Forscher, so lässt Lem seinen Protagonisten sinnieren, verhielten sich mithin nicht anders »als ein Wilder, der, nachdem er aus ein paar erzgescheiten Büchern ein Feuerchen gemacht und sich daran erwärmt hat, meint, er hätte seinen Fund großartig genutzt!« (S. 44) Auch durch diesen Roman geistert die Erinnerung an den Holocaust, als ein jüdischer Wissenschaftler sich der Szene einer Massenerschießung im Jahr 1942 in seiner Heimatstadt an der Ostfront erinnert. Ähnlich wie die Marsianer in ihren Kampfmaschinen bei H.G. Wells erscheint hier der deutsche Soldat als Hoheitszeichen einer erbarmungslosen Macht: »Es war ein junger, vollkommener Kriegsgott, groß, stattlich, in der Felduniform, auf deren silbernen Kragenspiegeln ein grauer Schimmer zu liegen schien, wie ein Hauch von Glut und Asche. Er war in voller Feldausrüstung: Eisernes Kreuz am Halse, Fernglas auf der Brust, Stahlhelm, die Pistole am Koppel handlich nach vorn geschoben, und in der behandschuhten Hand hielt er ein Taschentuch, sauber und sorgfältig gefaltet, das er von Zeit zu Zeit gegen die Nase drückte, weil die Erschießungen schon lange dauerten…« (S. 94f.) »Die Stimme des Herrn« bringt Lems Credo auf den Punkt: Das gesichtslos Bedrohliche ist nicht die extraterrestrische Zivilisation – es wird durch die Menschen selbst verkörpert.
Wie tief bei Lem nicht nur der Schrecken über die deutsche, sondern auch über die sowjetische Besatzungszeit saß, ist (in deutscher Sprache) kaum überliefert. Einzig ein privater Brief an den Übersetzer Michael Kandel gibt Einblick in das Grauen, das Lem in dieser Hinsicht ebenfalls miterlebte. Denn, so schrieb er: »[…] sie vergewaltigten Frauen nach der Entbindung, Frauen nach schweren Operationen, sie vergewaltigten Frauen, die in Blutlachen lagen«, und fügte zynisch hinzu, dass er damals durchaus gern an den Satan geglaubt hätte.28
Doch machte Lem nie transzendente Mächte für das Teufelswerk von Menschen verantwortlich. Vielmehr sah er die Gefahr der Verrohung von der Evolution selbst ausgehen: »Wir haben uns an Megatote gewöhnt. Unsere Fähigkeit, uns anzupassen und – dadurch bedingt – alles zu akzeptieren, ist eine unserer größten Gefährdungen. Wesen, die anpassungsmäßig hochflexibel sind, können nicht über eine Moral verfügen, die nicht auch dehnbar wäre.« (Die Stimme des Herrn, S. 108)
Zeit seines Lebens hat sich Lem mit Physik ebenso beschäftigt wie mit Metaphysik, mit der biologischen ebenso wie mit der technischen Evolution. Trost in einer religiösen Deutung konnte Lem angesichts der menschlichen Verheerungen jedoch wohl nicht finden; eine »Stimme des Herrn« gab es für ihn in der Wirklichkeit nicht. Allerdings schätzte er die seelisch heilsame Wirkung von Religionen, für deren »schlaueste Erfindung« er es hielt, dass sie »die reale Welt um einen transzendenten Anbau ergänzen, in dem alles repariert wird«.29 Und mit ernster »Hochachtung« betrachtete er die »moralischen Gebote, die uns unsere Nächsten und sogar unsere Feinde zu lieben heißen«.30
Blanke Verachtung hegte Lem indessen für Aberglauben, Scharlatanerie und Verschwörungstheorien. In beißenden Glossen veralberte er die Pseudowissenschaft eines Charles Berlitz oder Erich von Däniken, die millionenfache Auflagen erzielten.31 Und er war zornig über die »pseudoaufgeklärten Massen«, die »sich heute des Glaubens an den Herrgott schämen, doch sie schämen sich nicht, falsche Surrogate zu suchen und zu gebrauchen. Sie nehmen viel eher die Existenz fliegender Untertassen als Engel und eher das ›Bermuda Dreieck‹ als die Hölle zur Kenntnis.«32 Lem bedauerte, dass solcher »metaphysischer Trödel« offenbar sehr gesucht sei, als »ein Gegengift« zum »wichtigtuerischen apodiktischen Ton der Wissenschaft«.33
Wichtigtuerisch waren Lems wissenschaftliche Darlegungen nie, auch nicht in seinem naturwissenschaftlichen Hauptwerk, der »Summa technologiae«,34 in der er die Erkenntnismöglichkeiten summierte und in die Zukunft extrapolierte. Wie viele seiner Generation wurde Lem von den Hoffnungen in die Kybernetik als gesellschaftliches Steuerungsmodell enttäuscht. Doch nahm er es mit Humor und parodierte im Gegenzug die Technikgläubigkeit, so auch in »Die Stimme des Herrn«. Dies trieb seine Berliner Lektorin Jutta Janke vom Verlag Volk und Welt zur Verzweiflung, »weil es bei Lem für den Laien nie festzustellen ist, wann er wissenschaftliche Termini gebraucht und wann er eigenschöpferisch, sozusagen wortbildnerisch tätig ist (achtzig Prozent der Fremdwörter, die Lem unmäßig benutzt, waren mir unbekannt, das Klaussche Wörterbuch der Kybernetik half da ebensowenig wie das Fremdwörterbuch).«35 Der Verriss durch seine Lektorin – Lem spiele sich als »kybernetische Kassandra« auf – war wohl der Grund, weshalb das Werk in der DDR lange unveröffentlicht blieb. Zehn Jahre später schrieb Janke faktisch einen Widerruf und stimmte einer Publikation zu, da mittlerweile »die Lemgemeinde imstande ist, auch anspruchsvolle Science-Fiction-Texte widerspruchslos zu verkraften«.36 Lem dürfte es gefreut haben, hatte die Lektorin ihm damit doch die literarische Ernsthaftigkeit bescheinigt. Auch in Polen wurde sein Werk streng geprüft. So fasste Lem 1971 die »Pathologie der sozialistischen Verwaltung« im Polen der Ära Gierek in einem Essay augenzwinkernd in Termini der Kybernetik: Der staatliche »Automat« erzeuge seine eigene Illusion, seine »Dominanz wird zur Fiktion«, da sich das System wirksam gegen gesellschaftliche Impulse abschotte.37 Ein weiteres Mal in Lems Leben wurde die Zensur aktiv und beschlagnahmte diese Kritik.38 Hätte der Autor es damals wohl für möglich gehalten, dass in Polen genau 50 Jahre später ein »Year of Lem« zu Ehren seines 100. Geburtstages gefeiert werden würde?
Zu seinen Lebzeiten fand Lem angesichts des Leids, das insbesondere die deutsche Besatzungsmacht seiner Familie und seinem Land zufügt hatte, keinen Trost, aber wohl doch einen kleinen Moment der Versöhnung. Auch dies geschah – wie könnte es anders sein – per »Zufall«. So hielt Lem 1986 fest: »Ich erinnere mich bis auf den heutigen Tag an den Augenblick, als ich (diese Überzeugung hege ich) vor mehr als dreißig Jahren die Aussöhnung mit den Deutschen erlebte. Damals probierte ich Schuhe in einem Berliner Warenhaus an, als ein vielleicht vierjähriges Kind auf mich zukam und in seinem kindlichen Deutsch auf mich einplapperte, um mir Bilder in einem gerade gekauften Büchlein zu zeigen.« Die »vollkommene Unschuld des kleinen Jungen« erwies sich als »Argument für mein Gedächtnis«. Doch »das Gedächtnis zu einem weißen leeren Blatt zu machen, stand nicht in meinen Kräften«.39
Anmerkungen:
1 Stanisław Lem, Provokation. Autorisierte Übertragung aus dem Polnischen von Jens Reuter, Frankfurt a.M. 1981. Hier rezensiert Lem das fiktive Werk eines deutschen Holocaust-Forschers.
2 Siegfried Lenz, Schwejk als Weltraumfahrer. Über das Vergnügen, Stanisław Lem zu lesen, in: Werner Berthel (Hg.), Über Stanisław Lem, Frankfurt a.M. 1981, S. 188-192.
3 Timothy Snyder, Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, New York 2010.
4 Stanisław Lem, Mein Leben, in: ders., Science-fiction. Ein hoffnungsloser Fall mit Ausnahmen. Essays, Frankfurt a.M. 1987, S. 7-29, hier S. 14.
5 Vgl. hierzu Dieter Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941–1944, München 1997.
6 Lem, Mein Leben (Anm. 4), S. 14.
7 Überdies wurde ihm die Einbindung in eine Trilogie aufgenötigt. Lems Kampf gegen die Zensur ist neuerdings näher beschrieben bei Alfred Gall, Stanisław Lem. Leben in der Zukunft, Darmstadt 2021, S. 64-69. Der Titel der DDR-Ausgabe der Trilogie: Die Irrungen des Dr. Stefan T., Ost-Berlin 1959, 2. Aufl. 1979.
8 Zwei kurze Besprechungen des Romans: Günter Herburger, Vom Sterben. Stanisław Lems erster Roman »Das Hospital der Verklärung«, in: Berthel, Über Stanisław Lem (Anm. 2), S. 183-187; sowie Heinrich Vormweg, Der Zauberberg als Irrenhaus. Stanisław Lems »Hospital der Verklärung«, in: Werner Berthel (Hg.), Insel Almanach auf das Jahr 1976. Stanisław Lem. Der dialektische Weise aus Krakow. Werk und Wirkung, Frankfurt a.M. 1976, S. 183-186.
9 Lem, Mein Leben (Anm. 4), S. 9.
10 Ebd., S. 7f.
11 Ebd., S. 13f.
12 Tomasz Lem, Zoff wegen der Gravitation. Oder: Mein Vater, Stanisław Lem. Übersetzt von Peter Oliver Loew, Wiesbaden 2021, S. 1.
13 Lem, Mein Leben (Anm. 4), S. 14.
14 Ebd. Ders., Philosophie des Zufalls. Zu einer empirischen Theorie der Literatur. Aus dem Polnischen von Friedrich Griese, 2 Bde., Ost-Berlin 1988 (polnische Erstausgabe 1968).
15 Ders., Das Hohe Schloß. Deutsch von Caesar Rymarowicz, Ost-Berlin und Frankfurt a.M. 1974 (polnische Erstausgabe 1966).
16 Ders., Einleitung, in: Władysław Bartoszewski, Aus der Geschichte lernen? Aufsätze und Reden zur Kriegs- und Nachkriegsgeschichte Polens. Aus dem Polnischen von Nina Kozlowski und Jens Reuter, München 1986, S. 7-11, hier S. 9.
17 Einleitung zu Das Warschauer Ghetto – wie es wirklich war von Władysław Bartoszewski, abgedr. in: Lem, Science-fiction (Anm. 4), S. 142.
18 Ebd., S. 143.
19 Stanisław Lem, Philosophie des Zufalls. Zu einer empirischen Theorie der Literatur, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1983, S. 200.
20 Ebd., S. 201.
21 So betont er die »Manövrierfreiheit« von Jules Vernes, einem der Urväter der Science Fiction, in einem damals noch »bücher- und menschenleeren Raum« einer neuen literarischen Gattung. Lem, Mein Leben (Anm. 4), S. 19.
22 Matthias Schwartz, »The World as Holocaust«. Stanisław Lems experimentelle Poetik als Kunst des Überlebens, in: Jurij Murašov/Sylwia Werner (Hg.), Science oder Fiction? Stanisław Lems Philosophie der Wissenschaft und Technik, Leiden 2017, S. 145-167, hier S. 148.
23 Lem, Mein Leben (Anm. 4), S. 16.
24 Stanisław Lem, Nachwort zu H.G. Wells’ Der Krieg der Welten, in: ders., Essays. Übersetzt von Friedrich Griese, Frankfurt a.M. 1981, S. 147-161, hier S. 148.
25 Ebd., S. 148f. (dortige Hervorhebungen).
26 Ebd., S. 149.
27 Lem, Mein Leben (Anm. 4), S. 15f.
28 Stanisław Lem an Michael Kandel, 6. Mai 1977, in: Stanisław Lem, Der Widerstand der Materie. Ausgewählte Briefe. Aus dem Polnischen von Barbara Kulinska-Krautmann. Aus dem Englischen von Dino Heicker, hg. von Robert Barkowski, Berlin 2008, S. 298-304, hier S. 303.
29 Stanisław Lem/Stanisław Bereś, Lem über Lem. Gespräche. Aus dem Polnischen von Edda Werfel und Hilde Nürenberger, Frankfurt a.M. 1986, S. 383.
30 Ebd., S. 320.
31 Vgl. etwa die Rezension zu Charles Berlitz, Spurlos, in: Lem, Science-fiction (Anm. 4), S. 205-207.
32 Lem/Bereś, Lem über Lem (Anm. 29), S. 259.
33 Ebd.
34 Stanisław Lem, Summa technologiae. Aus dem Polnischen von Friedrich Griese, Frankfurt a.M. 1976, Ost-Berlin 1980 (polnische Erstausgabe 1964).
35 Bundesarchiv Berlin, DR 12374a, Bl. 240 (Gutachten, 17.1.1969), Lektor: Jutta Janke, Autor: Stanisław Lem, Titel: Die Stimme des Herrn.
36 Ebd., Bl. 242; Bl. 243 Anlage zum Gutachten Stanisław Lem, Głos pana (Die Stimme des Herrn), 23.10.1979.
37 Stanisław Lem, Angewandte Kybernetik: ein Beispiel aus dem Bereich der Soziologie, in: ders., Essays (Anm. 24), S. 362-391, hier S. 366.
38 Lem/Bereś, Lem über Lem (Anm. 29), S. 100.