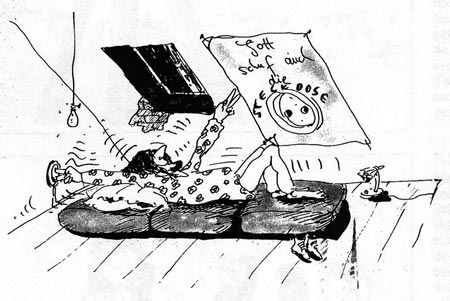hört die prophetischen verstärker was sie kreischen
hört die verstärker hört die verheißung
sie zerstört das alte und verkündet das neue
sie ist die revolution
ist das glück
die freiheit
willst du sie nun oder willst du sie nicht
willst du das glück
dann nimm es dir
willst du die freiheit
dann nimm sie dir
MACH DIE REVOLUTION
sofort
hier
jetzt
Helmut Salzinger, 1969.1
Nachdem die Auf- und Umbrüche der späten 1960er-Jahre lange Zeit vornehmlich aus politikgeschichtlicher Perspektive betrachtet wurden – als ideologische Neuorientierung in Gestalt einer „Neuen Linken“ oder „antiautoritären“ Bewegung sowie als Aufgipfelung und Radikalisierung von Reforminitiativen –, sind in den vergangenen Jahren verstärkt ihre kulturellen Aspekte untersucht worden. Der amerikanische Soziologe Daniel Bell charakterisierte die 1960er-Jahre schon 1976 als „period of noise“,2 und heute besteht Einigkeit darüber, dass im ebenso neuartigen wie vielstimmigen Sound der Sixties, wie ihn Autos, Fernseher und Mondraketen erzeugten, musikalische Klänge eine besonders wichtige Triebkraft des Wandels darstellten. Dabei ist allerdings noch weitgehend ungeklärt, wie sich Klang und gesellschaftlicher Umbruch genau zueinander verhielten.3 Wie hängt die kulturelle Innovation der elektroakustisch verstärkten Popmusik mit dem politischen Reformimpuls oder gar dem Streben nach einem revolutionären Umschlag zusammen? Wie wurden die neuartigen Klänge des Beat und Rock von den Beteiligten interpretiert? Welche Rolle spielten sie bei der Selbstverortung und in den kulturellen Praktiken Jugendlicher? In welchem Verhältnis standen die Gefühlsaspekte von Beat- und Rockmusik zu den textlich transportierten kognitiven Botschaften dieser Musik?
Derartige Fragen lassen sich nur beantworten, wenn man die Entwicklungen in den unterschiedlichsten kulturellen Sphären – materielle und politische Kultur, soziale Umbrüche, Kunst – als interdependente Prozesse begreift.4 Die von Marshall McLuhan und anderen postulierte Medienrevolution der 1960er-Jahre wurde nicht nur getragen von ihrem visuellen Kernstück, dem Fernsehen, sondern auch von weitreichenden Neuerungen auf dem Gebiet der auditiven Medien. Sie bereiteten auf der technischen Ebene den Boden für die sprunghaft wachsende Bedeutung der Musik als Form der gesellschaftlichen Kommunikation. Dabei stellten Beat- und Rockmusik, die aus den USA und Großbritannien in die Bundesrepublik kamen (und über Radio und Fernsehen auch die DDR erreichten), die entscheidende Basis für die Entstehung einer sozial übergreifenden Jugendkultur dar; sie schlossen deutsche Jugendliche an das populäre Klanggeschehen des Westens an, während nationale Moderatoren – Bands, Zeitschriften, Clubs, Konzertveranstalter, Radio- und TV-Formate – die Adaption landesspezifisch justierten und zugleich den westlichen Horizont durch eigene Beiträge mit formten.5
2![]()
Die Ende der 1940er-Jahre entwickelten Transistoren und ihre immer dichtere Verkoppelung in integrierten Schaltkreisen oder „Mikrochips“ seit Anfang der 1960er-Jahre ermöglichten nicht nur den kostengünstigen Bau tragbarer Audiogeräte wie etwa handtellergroßer Taschenradios oder Kassettenrekorder (beide seit 1965 auf dem westdeutschen Markt), die das Mobilitäts- und Separierungsbedürfnis Jugendlicher bedienten, sondern auch die Verbreitung stereophoner Heimgeräte von exquisiter technischer Güte.6 Offiziell standardisiert wurde Klangqualität in der Bundesrepublik durch die im Mai 1967 verbindlich gemachte DIN 45.500, die Deutsche Industrienorm für besondere Wiedergabetreue („High Fidelity“), die seitdem zum Markenzeichen für Exklusivität wurde.7 Leistungsfähige Stereoanlagen boten überhaupt erst die Möglichkeit, technisch differenzierte und brillant aufgezeichnete stereophone Dokumente wie etwa das im Juni 1967 veröffentlichte Beatles-Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ adäquat zum Klingen zu bringen. Zu Recht argumentierte der Vorsitzende des „Deutschen High-Fidelity-Instituts“, Karl Breh, auf der Düsseldorfer Messe „hifi 68“, durch die stereophone Wiedergabe in werkgetreuer Qualität werde „das gesamte Klanggeschehen durchhörbar“, so dass „die moderne Schallplatte in Verbindung mit Hifi-Stereophonie jedem Musikfreund die Möglichkeit bietet, ein Musikkenner zu werden“.8 Dass bei gesteigerter sozialer Durchlässigkeit auch weiterhin Differenzierung möglich blieb, dafür sorgte nicht zuletzt die breite Produktpalette der Anbieter. So waren die gestalterisch und technologisch gediegen ausgeführten Stereoanlagen von Braun nur im mittleren Alterssegment und in den einkommensstärksten Bevölkerungsschichten in statistisch relevanten Größenordnungen vorzufinden, während in den jüngeren und mit bescheideneren Mitteln ausgestatteten Gruppen die preisgünstigeren Geräte der Firma Grundig sowie No-Name-Fabrikate besonders verbreitet waren.9
Jedenfalls findet sich in der rasanten Ausbreitung von Radiogeräten, Plattenspielern, Tonbandgeräten und (seit Ende der 1960er-Jahre) Stereoanlagen ein Indikator für die wachsende Bedeutung nicht nur der Musik im Allgemeinen, sondern auch eines adäquaten Sounds im Besonderen. Dabei waren an avanciertem Klang vor allem technikaffin sozialisierte junge Männer interessiert, die in diesen Jahren den Fachdiskurs über Popmusik etablierten, bestimmten und als kulturelles Kapital ausspielten. Unter den 20- bis 29-jährigen männlichen Westdeutschen besaßen im Frühjahr 1969 rund 44 Prozent einen Plattenspieler und 11 Prozent eine Stereoanlage, wobei diese Werte mit 61 bzw. 17 Prozent von den Lesern der linken Publikumszeitschriften „Twen“ und „Pardon“ markant überboten wurden, die im zukunftsträchtigen Segment der Oberschüler und Studierenden mit einer Mischung aus Politik und Kultur reüssierten. Die noch in etwas stärkerem Maße in Ausbildung befindlichen Leser von „Konkret“ lagen mit 56 bzw. 16 Prozent nur knapp darunter.10 Nicht nur von der Ausstattung her, sondern auch im Hinblick auf den ihr zugemessenen immateriellen Bedeutungswert gehörten die Leser dieser Zeitschriften zu den avanciertesten Gruppen der Gesellschaft. Dass sie beträchtliche Teile ihrer noch nicht allzu üppigen materiellen Ressourcen in Unterhaltungselektronik investierten, zeigt, wie stark sie sich nicht nur über Politik, sondern auch über Musik definierten.11 Das elektronische Ensemble, das Zeitgenossen schon als Merkmal einer besonderen medialen Kompetenz der Kommune 1 aufgefallen war, schloss auch die große Masse junger Intellektueller an die Weltläufte an, nicht zuletzt an den Sound ihrer Zeit. Ein elektronisches Zeitalter begann in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre zugleich auf der Seite der Musikproduzenten, die aufgrund der rasanten Entwicklungen bei der Produktions- und Aufnahmetechnologie (Filter, Effektgeräte für Hall oder Echo, Verzerrer, Mischpult, Synthesizer etc.) vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Soundgestaltung erhielten.
Die Spezifik von Rockmusik liegt nicht in der auf Notenblättern festgehaltenen Melodik oder Harmonie, sondern in ihrer kollektiv erzeugten Klanggestalt, ermöglicht insbesondere durch elektroakustische Verstärkung.12 Zum Ausdruck kommt sie in der gesteigerten Klangvariabilität der Instrumente – allen voran der elektrischen Gitarre, die stimmlichen Charakter annehmen, aber auch die vielfältigsten Geräusche imitieren und durch Assoziationen sogar, wie in Jimi Hendrix’ bekannter Version des „Star Spangled Banner“, ein politisches Statement artikulieren kann – hier die Dekonstruktion des Nationalsymbols im Feuer des Vietnamkriegs.13 Rockmusik ist bestimmt durch ein „assoziatives Musizieren, das in die aufgebauten Klangbilder und Bewegungsmuster Haltungen, Gesten, Attitüden und Emotionen einlagert, die dem Alltag, der Bildsprache der Medien, der Mode usw. entnommen, weder übersetzbar noch verbalisierbar, auch nicht von den sozio-kulturellen Kontexten ablösbar sind, in denen sie ihren Sinn erhalten“.14 Dieser ästhetische Zugang zur Welt lässt sich nicht objektiv bestimmen, sondern ist in den „subjektiven Wahrnehmungsweisen und Bedeutungszuweisungen“ der beteiligten Akteure aufzuspüren.15
3![]()
Unterhaltungselektronisch gut ausgestattet:
Liebespaar in einer Hamburger Kommune, 1969
(bpk/Foto: Günter Zint)
Auch Lautstärke spielte eine zentrale Rolle: Beat- und Rockmusik mussten laut gespielt werden. So wollten es Produzenten wie Rezipienten, und dies bedeutete nicht nur eine maximale Einwirkung auf den Hörsinn, die die in der Industrieproduktion zulässige Dezibelgrenze überschritt und so Bedenkenträgern ein wohlfeiles Argument an die Hand gab. Überdies erreichte der technologische Fortschritt, dass Wiedergabe- und Empfangsgeräte mit einem Frequenzspektrum von etwa 20 bis 20.000 Hertz das menschliche Hörvermögen nahezu vollkommen ausschöpften. Hochintensive niedrigfrequente Töne versetzten den Körper spürbar in Schwingung – ein Effekt, mit dem schon vor dem elektronischen Zeitalter der Klang von Orgeln Kirchgänger wohlig durchwärmt hatte, und der nun durch Rechtsdrehung am Bassregler des Stereo-Verstärkers beliebig zu steigern war.16 Genüsslich zitierte der „Spiegel“ 1966 im Rahmen einer Titelstory über „Sex in Deutschland“ eine 16-jährige Oberschülerin aus Donauwörth mit der Auskunft, Beatmusik sei so laut, „daß der ganze Unterleib innerlich mitvibriert“.17 Die seit dem Boom der Stereophonie beliebten Kopfhörer intensivierten die Aufwertung des Körpers als Resonanzraum noch und kehrten sogar die Verhältnisse um, indem sie den Eindruck erzeugten, der Sound entstehe im Innern des Kopfes. Der Rezipient wurde nicht mehr von musikalischen Einwirkungen umgeben, er wurde selbst zum Klanguniversum.
Ganz unabhängig vom Text ermöglichte der Sound der Rockmusik komplexe Weltdeutungen. Er wurde als „materialisiertes Bewusstsein“ (Peter Wicke) aufgefasst, das auch politische Positionen enthalten konnte. Angelegt war dies im antikommerziellen Selbstverständnis „progressiver“ Rockmusik, das sich im permanenten Widerspruch zu den Verwertungsmechanismen des Musikgeschäfts befand, zur Aufrechterhaltung ihres Authentizitätsanspruchs jedoch essenziell war. Dem antikapitalistischen Zeitgeist entsprechend wurden politische Positionen gelegentlich auch in den Texten formuliert. Doch im Kern wurde das rebellische Potenzial der Rockmusik nicht in politisch expliziten Aussagen gesehen, sondern im Sound – nicht zuletzt deshalb, weil der Sound grundsätzlich als „authentisches“, nicht entfremdetes Kommunikationsmedium zwischen Band und Publikum betrachtet wurde. Joe McDonald von „Country Joe and the Fish“ etwa proklamierte, die Musik der Revolution werde „elektrisch verstärkte Rock-Musik“ sein, sie werde einen „exakten Beat haben und auf elektrischen Gitarren und Bässen gespielt werden“.18 Auf diese Weise konnte schon die Teilnahme an einem Rockkonzert oder die Rezeption daheim als politische Aussage betrachtet werden, auch ohne ausdrückliche Reflexion oder Stellungnahme.
Im Folgenden wird die Bedeutung elektroakustisch verstärkter Musik in der Bundesrepublik um 1968 in drei Schritten untersucht. Erstens wird der Kampf der Beat- und Popmusik um gesellschaftliche Anerkennung beschrieben, zweitens die Bedeutung des technisch verstärkten Klangs für die Entstehung einer jugendlichen Massenkultur dargestellt und drittens das Verhältnis von Klang und Text analysiert. Diese Skizze beruht entsprechend des multiperspektivischen Zugangs auf heterogenem Material; neben Quellen des Jugendschutzes, der Rechtsprechung, der Branchenpublizistik sowie ungedruckten Akten – etwa Steuerakten des „Star-Clubs“ – werden insbesondere kommerzielle Jugendzeitschriften und Alternativzeitungen herangezogen, in denen die Rezipienten selbst zu Wort kommen. Quellen aus der Konsumforschung helfen zudem, das qualitative Material im Hinblick auf seine gesellschaftliche Bedeutung zu gewichten und Differenzierungen nach Geschlecht, politischem Interesse oder sozialer Lage vorzunehmen.
4![]()
Viele Jahre lang galten Beat- und Rockmusik als Präferenzen einer von der Gesamtgesellschaft separierten Jugendkultur – auch deshalb, weil auf staatlicher Seite umstritten war, ob den elektroakustisch verstärkten Klängen jugendlicher Bands überhaupt ein Kulturwert zuzumessen sei. Als Mitte der 1960er-Jahre Beatmusik zum bevorzugten Sound Jugendlicher geworden war und von immer mehr Erwachsenen als jugendgemäß akzeptiert wurde, eskalierte der Streit darum, inwieweit sie auch von Rechts wegen als legitimes Kulturgut angesehen werden könne. Ähnlich wie Sexualdarstellungen in den Medien, lange Haare bei jungen Männern oder abweichendes Verhalten in der Öffentlichkeit in Gestalt der „Gammler“ wurde elektrisch verstärkte Musik zu einem Kampffeld um die Respektabilität neuer Themen, Stile und kultureller Ausdrucksformen. An den Auseinandersetzungen, die die Vertreter dieser Innovationen mit Ämtern und Gerichten führten, werden die kulturellen Umschichtungen, ihre Möglichkeiten und Grenzen, besonders deutlich. Der Gründer des Hamburger „Star-Clubs“, Manfred Weißleder, lieferte sich mit dem zuständigen Bezirkssteueramt Hamburg-Mitte einen langjährigen Rechtsstreit um die Frage, ob Beatveranstaltungen als Vergnügen oder Kunst anzusehen seien – eine Alternative, die auch viel über den damaligen Kunstbegriff aussagt. Nach dem Hamburger Vergnügungssteuergesetz waren Eintrittsgelder bei Veranstaltungen, die hauptsächlich dem Vergnügen dienten, mit 20 Prozent zu versteuern, während auf Konzerte, die der Hochkultur zugerechnet wurden, ein reduzierter Steuersatz von 10 Prozent zu entrichten war. Diese Differenz schlug bei der großen Besucherzahl des „Star-Clubs“ beträchtlich zu Buche. Weißleder schritt Anfang 1966 zur Tat, als Beatmusik in der Öffentlichkeit bereits weitgehend anerkannt war, manche Veranstaltungen seines Hauses einen stärker konzertanten Charakter angenommen hatten und ein Konflikt an anderer Stelle das Legitimitätsproblem auf die Tagesordnung gesetzt hatte.
Eingang zum Hamburger „Star-Club“, 1962
(Foto: Peter Brüchmann/K&K)
Nach der Deutschlandtournee der „Rolling Stones“ vom September 1965 hatte die Stadt München vom Veranstalter Karl Buchmann Vergnügungssteuer in Höhe von mehr als 14.000 DM gefordert – ein Vorgang, den die Regierung von Oberbayern mit der Begründung billigte, bei dem Gebotenen handele es sich nicht um Musik, sondern (vor allem wegen des Einsatzes elektrisch verstärkter Instrumente) um „Lärm“.19 Mit dieser Definition wurde die eben verabschiedete liberale Neufassung des bayerischen Vergnügungssteuergesetzes von 1965 umgangen. Die Novelle hatte Konzerte generell steuerfrei gestellt, nachdem es um die alte Formulierung, lediglich musikalische Darbietungen von „künstlerisch hohem Wert“ würden nicht besteuert, immer wieder Deutungskämpfe gegeben hatte. Als sich die Stadt München mit Buchmann anlegte, ging es um die Frage, ob diese Steuerbefreiung auch für Beatmusik gelten sollte. Im Juni 1966 entschied das Bayerische Verwaltungsgericht zugunsten Buchmanns – nachdem es an einem Beat-Konzert teilgenommen und sich vom Bayerischen Fernsehen eigens zwei Fernseh-Beat-Shows hatte vorführen lassen. Es befand, bei den Darbietungen von Beatbands handele es sich zweifelsfrei um Musik; die Neufassung des Vergnügungssteuergesetzes habe gerade beabsichtigt, das Musikleben nicht steuerlich zu beeinflussen: „Deshalb müssen Beat-Veranstaltungen auch dann als vergnügungssteuerfrei hingenommen werden, wenn ihnen vielleicht die Mehrheit der Bevölkerung empört und verständnislos gegenübersteht.“20
Diese klare Entscheidung zugunsten der Populärkultur ermutigte auch Weißleder, doch wie die Dinge anderwärts ausgehen würden, war damit keineswegs ausgemacht. In der Gesellschaft gab es nach wie vor erhebliche Vorbehalte gegenüber den musikalischen Vorlieben Jugendlicher, die sich auch in der Rechtsprechung niederschlugen. Wie die Haarlänge oder die Geschwindigkeit von Mopeds war auch die Lautstärke ein Terrain, auf dem erbitterte Kämpfe um kulturelle Legitimität ausgefochten wurden. Im Elternhaus war der subjektive Eindruck der Erziehungsberechtigten maßgeblich. Bei Beatkonzerten wurde nicht selten die Lautstärke gemessen. Während des Recklinghauser Beat-Festivals von 1967 hob der aufsichtführende Beamte die Polizeikelle, sobald die als angemessen erachtete Phonzahl überschritten war, und die Verstärker mussten heruntergefahren werden.21 Dass eine liberale Haltung auch in der Jurisprudenz umkämpft war, zeigte sich wiederum in Bayern. Im April 1967 kassierte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Vorjahresentscheidung mit dem Argument, Beat-Veranstaltungen genügten in der Regel nicht den Ansprüchen eines Konzerts, denn die jugendlichen Teilnehmer verhielten sich nicht rezeptiv, sondern schrien und tanzten – und seien damit „am Veranstaltungsgeschehen aktiv beteiligt“.22 Diese Argumentation hatte die Hamburger Steuerbehörde im Streit mit Weißleder entwickelt und damit am Ende obsiegt.
5![]()
Während Weißleder der Auffassung war, dass „jede Art von virtuoser, instrumentaler Darbietung ohne besondere Würdigung des interpretierten Musik-Stiles als künstlerisch hochstehend einzustufen ist“ und dass dies für das „von internationalen Spitzenbands“ bestrittene Programm des „Star-Clubs“ ohne weiteres zutreffend sei, argumentierte das Finanzamt, selbst wenn ein Teil der dort präsentierten Darbietungen „konzertanten Charakter“ habe, sei doch entscheidend, dass dabei getanzt werde.23 Tanz oder nicht Tanz – das wurde aus staatlicher Sicht zur differentia specifica zwischen Veranstaltungen der Hochkultur und profanem Vergnügen. Selbst Hubert Fichtes Lesung aus seinem Roman „Die Palette“ am 2. Oktober 1966 wurde mit 20 Prozent besteuert – weil im Anschluss daran zur Musik der mitwirkenden Bands auch getanzt werden durfte.24 In diesen Streit griff die Hamburger Kulturbehörde ein, die den Schulterschluss mit Jugendschutz und Steuerbehörde suchte und Weißleders Position durch ein künstlerisches Werturteil entscheidend schwächte: „Die Musikdarbietungen (Twist & Beat) des Clubs entsprechen nicht im geringsten den Anforderungen kultureller Darbietungen. Die Musik ist eher geeignet, die Knochen und Ohren der jungen Menschen zu schädigen.“25
Letztlich entschieden wurde die Sache durch ein Urteil des Finanzgerichts Hamburg von 1970, das Weißleders Klage abwies. In der Urteilsbegründung hieß es ganz analog zur Letztentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, bei den Darbietungen des „Star-Clubs“ handele es sich um „Vergnügungen“, die der Zerstreuung und Unterhaltung dienten, nicht um „Konzerte“ – ein Veranstaltungstypus, bei dem „als einziger Inhalt von einer oder mehreren Personen einem zuhörenden oder zusehenden Publikum Musik geboten wird. Während solcher musikalischer Darbietungen verhält sich das Publikum in der Regel rezeptiv, ohne nennenswerte eigene Aktivitäten nach außen hin zu entfalten.“26 Bei den Darbietungen von Beatbands hingegen werde durch „Körperbewegungen und Verrenkungen sowie durch Gestik und Mimik [...] eine Schau“ geboten und vom Publikum getanzt – beides und insbesondere in dieser Kombination Merkmale, die dem Charakter eines „Konzertes“ widersprächen. Kontemplation versus Aktivität – das waren die Pole, die im Jahre 1970 immer noch E- und U-Kultur voneinander unterschieden.
Zwar war diese bipolare Konstruktion durch die tatsächliche Entwicklung in der Popmusik praktisch längst überwunden, doch obsiegten in der rechtlichen Sphäre kulturelles Distinktionsbedürfnis und finanzielles Staatsinteresse. Anders als noch in der Münchener Entscheidung allerdings wurde dabei vermieden, die klangliche Qualität von Musik zu bewerten. Als „Lärm“ wurden Beat- und Rockmusik in der Rechtsprechung nicht mehr diskreditiert, doch das bedeutete nicht, dass man bereit gewesen wäre, von jeglichem ästhetischen Werturteil Abstand zu nehmen. Dieses Urteil orientierte sich nun am empirisch beobachtbaren Aufführungs- und Rezeptionsverhalten von Künstlern und Publikum.
6![]()
2. Elektrifizierung und Massenaktivität
Unter Jugendlichen erlangten Beat- und Rockmusik enorme Popularität – nicht nur in der Rezeption, sondern wegen der niedrigen Zugangsschwelle für Amateure auch in eigenen Versuchen. Elektrisch verstärkte Instrumente boten Jugendlichen die Möglichkeit, sich aus der Rolle des rezeptiven Konsumenten zu lösen und sich in der Öffentlichkeit auf prestigeträchtigem Terrain kreativ zu betätigen. Besondere Vorkenntnisse waren nicht erforderlich, weil zentrales Merkmal von Beatmusik nicht Kunstfertigkeit im klassischen Sinne war. Erst Lautstärke und Klang, die durch Mikrofon, Tonabnehmer und Verstärker beliebig variierbar waren, bewirkten jenes „Involvement“, das eine Vergemeinschaftung der jugendlichen Rezipienten über das Medium der Musik ermöglichte und Erwachsene abschreckte.27 Eine zentrale Rolle spielte die Brettgitarre, die über ein elektroakustisches Verstärkersystem zum Klingen gebracht und als musikalische Stimme eingesetzt wurde. Sie eignete sich besonders zur Demonstration solistischer Virtuosität. Die Elektrifizierung ermöglichte nicht nur zuvor ungekannte Sound-Effekte, sondern auch eine große akustische Reichweite, und gab dem Gitarristen mehr Spielraum für eine expressive Bühnenshow.28 Die E-Gitarre wurde das herausragende Symbol für die gemeinschaftsbildende Funktion von Beat- und Rockmusik; sie suggerierte Aufruhr und Befreiung und wurde in den unterschiedlichsten Formen für kommerzielle und politische Botschaften verwendet. Gegenüber dem rezeptiven Verhalten stand musikalische Eigenaktivität zwar deutlich zurück, doch beherrschte 1965 fast jeder Fünfte der 14- bis 21-Jährigen ein Instrument – bei den Jungen hatten die „Jazzinstrumente“ (dazu wurde auch die Gitarre gezählt) mit etwa einem Drittel bereits mit den klassischen Instrumenten Klavier und Geige gleichgezogen, während sie bei den Mädchen mit 11 Prozent zu 43 Prozent nachrangig positioniert waren.29 Im selben Jahr registrierte der Bundesverband der deutschen Musikinstrumentehersteller „im Zuge des Beatbooms“ eine Umsatzsteigerung von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr; 1967 machte der Posten „Mikrofone, Verstärker und Lautsprecher“ mit knapp 150 Millionen DM etwa 40 Prozent des Branchenumsatzes aus.30
Elektrizität, die Lautstärke und Klangvariationen erst ermöglichte und Mitte der 1960er-Jahre von der Bevölkerung weithin wohlwollend betrachtet wurde, erlangte für die jungen Altersgruppen zentrale Bedeutung.31 Das Entscheidende am Beat war, so sah es 1966 Rolv Heuer in „Konkret“, dass er sich die Steckdose als „Tabernakel dieses Jahrhunderts“ zunutze machte und die Klanglandschaft der modernen Gesellschaft in die Sphäre der Kunst transponierte: „Plötzlich hatte man die Autobahn auf der Bühne, die Maschinenhallen, das ganze Mobiliar einer industrialisierten Welt. Die Musikinstrumente wurden nicht mehr verzärtelt und auf das Podest ‚Kunst‘ gestellt, sie erschienen zum erstenmal als Werkzeug, machten den Fräsen und Kreissägen Konkurrenz.“32 Damit eroberte der Klang des industriellen Alltags die Sphäre der Kunst, die – sieht man einmal ab von den Experimenten der musikalischen Avantgarde seit Luigi Russolo – von jeglicher Maschinenakustik gerade hatte freigehalten werden sollen. Die davon ausgelöste Wirklichkeitssuggestion trug erheblich zur Anziehungskraft der Beat- und Popmusik bei, die als Sound der Zeit empfunden wurde. Vor allem über den Aufstieg des elektronischen Ensembles der Unterhaltungsmusik erhielt Elektrizität unter jungen Westdeutschen einen derart positiven Nimbus, dass der Fotograf Will McBride der „Lust auf Technik“ einen zentralen Stellenwert im Idealbild des „Neuen Menschen“ einräumte (illustriert durch eine Fotomontage, die ein Stromkabel als Phallus darstellte). Die Zeitschrift „Pardon“ sah sich zu einer Satire über die neue „Stromsucht“ veranlasst, die die Abhängigkeit Jugendlicher von der Steckdose aufs Korn nahm.33 Dabei waren nicht nur die Benutzung von E-Gitarren, sondern mehr noch Bau und Reparatur elektronischer Gerätschaften ein maskulines Terrain. Eine Neigung zu derartigen Basteleien war von Vorteil, denn E-Gitarren und Verstärker waren teuer und wurden vor allem in der Frühzeit der Beat-Bewegung häufig selbst gebaut, bevor industriell gefertigte Geräte angeschafft werden konnten.34
In der konservativen Kulturkritik wurde die Elektrifizierung der Musik als weiterer Markstein auf dem Weg zur kulturellen Verflachung betrachtet, welcher der „außengeleitete“ Mensch ausgesetzt sei. Auch schien die Arbeit als Grundfeste der Gesellschaft gefährdet, weil elektrifizierte Musik die Illusion nähre, ohne besonderen Aufwand schnell viel Geld verdienen zu können. Angesichts des Aufstiegs der Beatles meinten Jugendliche, sie benötigten für einen ähnlichen Erfolg „vor allem einen elektrischen Verstärker für die Gitarre“ – so eine kulturpessimistische Stimme.35 Ein anderer Autor kritisierte die mit Demokratisierungseffekten verbundene Verlagerung von der Gesangsausbildung zur Bühnenperformance: „Die Anwendung eines Mikrophons [...] gibt der dürftigsten Stimmqualität und -quantität Auftrieb. Mit anderen Worten: der elendeste Stümper kann mit der Verstärkung seiner Stimme in die Lage versetzt werden, sich einem Publikum zu präsentieren. Kein Wunder, daß die meisten Mikrophonsänger der Schlagerindustrie stimmlich nichts können.“36 Noch bis weit in die 1970er-Jahre hinein wurde in diesen Kreisen Popmusik als kulturell bedrohlicher „Lärm“ beurteilt. Diese Denunziation rückte die Beatmusik zudem in den Kontext der industriellen Revolution und postulierte das vormoderne Ideal einer organischen Identität von Klang und Quelle, Stimme und Körper.37 Allerdings war dieses Werturteil, wie zu sehen war, rechtlich schon nicht mehr haltbar.
7![]()
In den höheren Bildungsschichten, insbesondere ihrem männlichen Segment, entstanden am Ende der 1960er-Jahre sozialrevolutionäre Ideen, die mit dem Lob der Elektrifizierung zu einem technisch grundierten Fortschrittspathos verschmolzen. In der Szenerie der aktiven Beatmusiker wurde Technik im Allgemeinen als „Befreiungsinstrument“ betrachtet,38 und politisch gestimmte Protagonisten der Popmusik sahen in ihren Instrumenten Werkzeuge der Revolution. Aus der Sicht junger Männer wurde diese Vision von Künstlern verkörpert, die sich ganz besonders durch die virtuose Handhabung ihrer E-Gitarren auszeichneten – allen voran Jimi Hendrix.39 In einem Artikel über „Revolution und Krach“ beschrieb Robert Scheermann anhand ihres Gebrauchs durch Hendrix die besondere Bedeutung der elektrischen Gitarre, die nicht nur laut sei, sondern durch Verzerrung und Rückkopplung „ein völlig neues Instrument“ werde: „Sein unerhört kreatives Spiel geht weniger um Noten und Melodien als um Klänge, die er mit seinem Instrument erzeugt, verstärkt, verwischt und hintereinander herjagt. Diese Klänge geben Erfahrungen wieder, mit Blues, mit Rock, mit Straßenlärm, Musikboxen und Raketen.“40
Auch ein Rückblick auf den Hendrix-Auftritt vom März 1967 im „Star-Club“ vermittelt einen Eindruck von der Zäsur in Klangproduktion und -rezeption, die die eigenwillige Nutzung des elektroakustischen Potenzials bedeutete: „Hendrix schloss die Gitarre an und ließ sie gleich ganz wahnsinnig losheulen und pfeifen, wir dachten erst, seine Anlage ist kaputt. Aber dann legten Schlagzeug und Bass los, und Hendrix würgte seine Gitarre, biß rein und spielte mit der Zunge und auf dem Rücken und unterm Knie, und er haute sie gegen den Marshall-Turm, das klang so, als explodierte gerade ein Elektrizitätswerk. Dazu verzog er ständig sein Gesicht, das war ein voller Film, der da ablief, also auf dem Gesicht konnte man richtig die Töne sehen, die er erzeugte. Dazu denn noch seine heisere Stimme, die wilden Haare und die kaputte Uniformjacke, die er am ersten Abend trug – das hat uns alle völlig fertiggemacht. Daß da noch andere Leute mit auf der Bühne standen, haben wir gar nicht mitgekriegt. Wir haben immer nur diesen Kerl gesehen, der da Sachen machte, die so total wahnsinnig waren, daß wir gar nicht begreifen konnten, daß es so was gibt. Zum Schluß hat er dann Wild Thing gespielt, über zehn Minuten lang, in einer Mörderversion. Als er fertig war, waren wir auch alle fertig. Keiner ist gegangen, alle blieben da, um ihn um Mitternacht noch mal zu sehen.“41 In Hendrix’ Stil zeigte sich, dass elektrisch verstärkte Musik in der Lage war, das ganze industrielle Ensemble der Moderne akustisch zu simulieren und zu interpretieren. Sie löste damit geradezu schockartige Wirkungen aus und reproduzierte eine grundlegende Erfahrung der industriellen Moderne – die radikale Destruktion traditioneller Hörgewohnheiten.42 Die Technik selbst suggerierte derartige Diskontinuitätserfahrungen und ermöglichte künstlerische Deutungen, ja setzte sie sogar auf die Tagesordnung. Es waren vor allem, so der bereits zitierte Robert Scheermann in Anlehnung an Walter Benjamin, „die technischen Möglichkeiten der Reproduktion, die einen Musiker gewissermaßen zur Kreativität zwingen“.43
„Das hat uns alle völlig fertiggemacht“: Jimi Hendrix in Hamburg, 17. März 1967
(ullstein bild – C.T. Fotostudio)
Theoretisch untermauert wurde der Bedeutungswandel des Klangs in den sensorisch hochgespannten späten 1960er-Jahren durch einen Paradigmenwechsel von Theodor W. Adorno zu Walter Benjamin. Während Adornos Kritik der Kulturindustrie keinen Ausweg aus dem Zirkel von Manipulation und „rückwirkendem Bewußtsein“44 der Rezipienten sah, eröffnete Benjamins Essay zum „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ einen Weg, die modernen Massenmedien als Werkzeuge der Emanzipation zu begreifen.45 Für die Rockmusik als bedeutendste auditive Neuschöpfung der Medienkultur hat dies der Literaturkritiker und Musikkolumnist Helmut Salzinger 1972/73 am ausführlichsten begründet. Salzinger sah „die gegenkulturelle Bewegung“ als „einzige gesellschaftliche Kraft“, die die Forderung Benjamins erfüllen könne, die Konsumindustrie mit kulturellen Neuerungen nicht nur zu beliefern, sondern gleichzeitig auch „umzufunktionieren“.46 Ihm zufolge zielte Benjamins Postulat einer „Politisierung der Kunst“ nicht auf eine politische Tendenzkunst. Rockmusik sei „revolutionäre Musik“ – ganz unabhängig von etwaigen politischen Texten und überhaupt von politischen Urteilskriterien, sondern vielmehr im Lichte von Benjamins Ästhetik, derzufolge die Produktivkräfte Technik und Massenproduktion zur Überwindung des Kapitalismus drängten: „Während die Agenten der Kulturindustrie lediglich einen Massenartikel an den Mann zu bringen glauben, vertreiben sie zugleich den Sprengstoff, mit dem die Fundamente ihres Systems unterminiert werden. Das aber ist nicht so sehr das Ergebnis einer dieser Kunst übergestülpten inhaltlichen Tendenz, sondern ihrer Herstellungstechnik.“47 Kunst war demokratisch, weil sie reproduzierbar geworden war – potenziell jedermann konnte sie nicht nur rezipieren, sondern auch produzieren. Salzingers Interpretation fand Widerhall, weil sie die von Benjamin ausgehende „Bewegungssuggestion“48 auf das Gemisch aus radikaler Politik und Hedonismus anwandte, das seit 1967 in der Gegenkultur brodelte.49
8![]()
Wie nun verhielten sich dazu jene Intellektuellen, die just erheblich dazu beigetragen hatten, die Bundesrepublik für Reformen zu sensibilisieren, und die gelegentlich sogar für eine grundlegende Umwälzung der Gesellschaft eintraten – aber bislang in erster Linie auf die Wirkung des Wortes gesetzt hatten? Einige Wortkünstler gingen angesichts der Mobilisierungskraft elektrisch verstärkter Musik zum Beat über, um ihre Botschaften an die ganz offensichtlich am stärksten protestbereite Gruppe der westdeutschen Gesellschaft zu bringen – so etwa die Kölner Truppe „Floh de Cologne“, die genug davon hatte, als Kabarett den modisch gewordenen Habitus der Progressivität im örtlichen Bürgertum zu bedienen. 1969 griffen die Studenten der Theaterwissenschaft zu Schlagzeug und E-Gitarre und wurden, angelehnt an Vorbilder wie die amerikanischen „Fugs“ und „Mothers of Invention“, eine der bekanntesten politischen Rockbands der Bundesrepublik.50 Radikaler, aber auch musikalisch weniger zugänglich und daher weniger erfolgreich agierte die Karlsruher Band „Checkpoint Charlie“, deren „Terror-Rock“ (Eigenbezeichnung) jede Art von Gefälligkeit ausschloss. Der Spiritus rector dieser Gruppe, Uwe von Trotha, notierte im Rückblick, die ständige Provokation habe „oft eine feindselige Atmosphäre zwischen den Hörern und uns geschaffen, eine Barriere, vor der politische Information nicht selten gestoppt wurde“.51
Am erfolgreichsten wurde „Ton Steine Scherben“, eine Gruppe, die nach frühen Anfängen einer englisch singenden Beatband aus der Agitationstruppe „Hoffmanns Comic Teater“ hervorgegangen war. Die große Resonanz, die die Band in der linken Szene fand, basierte erstens darauf, dass ihre Mitglieder so alt waren wie ihr Publikum; sie hatten vergleichbare soziale Hintergründe und lebten in ähnlichen Milieus. Zweitens verstand die Band Musik als „eine Waffe“ und verknüpfte wie keine andere Formation harte Rockmusik mit radikalen Texten – bei Live-Auftritten noch visuell unterstützt durch Dias – zu einer aggressiven und mobilisierenden Mischung.52 Und drittens machte sie als einzige populäre Rockgruppe „wirklich freie Musik“, wies alle kommerziellen Angebote zurück und setzte konsequent auf Eigenproduktion.53 Besonders radikal wirkte „Ton Steine Scherben“ auch deshalb, weil Militanz in ihren Texten einen zentralen Stellenwert einnahm, während die andere Seite ihres Faszinosums aus sanften, ganz privaten, teils surrealen Songs bestand, die Liebe und Zusammenhalt beschrieben – jene zweite Seite des linken Gemeinschaftsradikalismus, wie sie in der vielfach beschriebenen Utopie vom einfachen, guten Leben aufschien.
Das Alter der Musiker war für den Zugang zur Rockmusik sehr wichtig. Es entschied nicht zuletzt darüber, ob ihr Sound als „natürlich“ oder „aufgesetzt“ wahrgenommen wurde – was den „Scherben“ einen kaum einholbaren Vorteil vor den etwa zehn Jahre älteren „Flöhen“ verschaffte. Ihnen gegenüber kamen die noch etwas älteren Protagonisten des politischen Liedes der 1960er- und 1970er-Jahre, die Liedermacher, aus einer anderen Tradition, nämlich vom französischen Chanson her, das die liedhafte Grundform für mannigfaltige poetische Betrachtungen zu Alltag und Politik abgab.54 Auch die Szene der Chansonniers, Folksänger und Liedermacher, die seit 1964 eine Heimat auf der Burg Waldeck im Hunsrück gefunden hatte, veränderte sich durch Intermedialität, Popularität und Politisierung, wobei die Modernisierung des Sounds die herausgehobene Bedeutung des Textes nicht berührte. In der weiterhin links geprägten Kulturszene und den neuen sozialen Bewegungen der 1970er-Jahre spielten sie eine bedeutende Rolle.55
9![]()
Der Jurist und Schriftsteller Franz Josef Degenhardt (geb. 1931 und damit 19 Jahre älter als „Scherben“-Frontmann Rio Reiser) fand bei seinem ersten öffentlichen Auftritt auf dem Festival von 1964 ein Publikum, das seine „Bänkellieder“ zu schätzen wusste. Degenhardt-Songs wurden von manchen politisch sensiblen Zeitgenossen nahezu obsessiv rezipiert, weil sie ebenso poetisch wie präzise und unerbittlich die Doppelmoral der Wirtschaftswundergesellschaft analysierten – die Gegenwart des Nationalsozialismus („In den guten alten Zeiten“), Persistenz sozialer Ungleichheit („Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“), Ressentiments gegenüber Normabweichungen jeglicher Art („Tante Th’rese“, „Tonio Schiavo“).56 Als sich die Zeitkritik seit 1968 ins Offensive wendete, wurden Degenhardts Texte zum Teil plakativ-politisch, beschworen aber auch die Gemeinschaft einer hedonistischen Linken. Musikalisch modernisierte er das Arrangement durch gelegentlichen Schlagzeug-Einsatz und elektroakustisch verstärkte Instrumente, die Anklänge an populäre Stile wie Rock, Reggae und später Rap zeigten. Allerdings blieb die akustische Gitarre das tragende Instrument, und im Mittelpunkt stand der Text. Noch 1971 stand der Sound der Zeit im Verdacht der kulturindustriellen Manipulation, wie „Die Wallfahrt zum Big Zeppelin“ andeutet – ein Lied, das die scheinbar unpolitischen Musik- und Drogenadepten der Woodstock-Zeit mit der Politikferne der Jugendbewegung der Jahrhundertwende parallelisierte: „Big Zeppelin, Big Zeppelin/hing an zwei schwarzen Sonnen./Und aus Verstärkern dröhnt im Bauch/die Litanei der Wonnen./Und Wolken aus Afghanistan/und stampfende Gitarren/und Schreie nach Befriedigung/nach Klassenkampf der Narren.“57
Nicht der Text, sondern der von elektroakustisch verstärkten Instrumenten erzeugte Klang war das charakteristische, mobilisierende und vergemeinschaftende Element der in den 1960er-Jahren entstandenen Beat- und Rockmusik. Ganz unabhängig vom Text transportierte ihr Sound Botschaften, die offen für politische Konnotationen waren: einen Wirklichkeits- und Authentizitätsnimbus, der sein Material aus der Klanglandschaft der industriellen Moderne gewann und sie zugleich überstieg. Der Klanghistoriker R. Murray Schafer postulierte, die ein alternatives Leben verheißenden „good vibes […] traveled a well-known road, which finally led from Leeds to Liverpool; for what was happening was that the new counterculture, typified by Beatlemania, was actually stealing the Sacred Noise from the camp of the industrialists and setting it up in the hearts and communes of the hippies“.58 Verbunden mit einem Wertehimmel, der die arbeitsteilig-technokratischen Gesellschaften des Westens grundsätzlich in Frage stellte, einem subkulturellen Lebensstil und Texten, die Pazifismus, Antikapitalismus und die alternative Gemeinschaft propagierten, wurden diese Klänge zum adäquaten Sound der Revolte der späten 1960er- und 1970er-Jahre.
Dabei sind unterschiedliche Mischungsverhältnisse von Klang und Text zu beobachten, die feinste Positionierungen ermöglichten. Mit dem Vorrang des performativ erzeugten Klangs entstand auf dem Gebiet der Musik zugleich ein Gegenprogramm zur Schriftfixierung der Moderne, wie sie sich in der Notation niedergeschlagen hatte.59 Daher fanden sich unter den Anhängern des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Leslie A. Fiedler, der 1968 die literarische Moderne als passé bezeichnete, eine Ausdehnung des Literaturkonzepts auf Trivialliteratur forderte – Western, Comics, Science Fiction, Pornographie – und die Mythen für legitim erklärte, die die Massenkultur erzeugte, besonders viele Protagonisten der frühen Pop-Literatur.60 Jüngere Künstler wie Peter O. Chotjewitz, Peter Handke und Bazon Brock galten als Spezialisten für Popmusik und wurden 1968 vom Norddeutschen Rundfunk für die 14-tägige Sendereihe „Autoren als Disk-Jockeys“ verpflichtet. Derartige Fusionen von Literatur und Musik bauten auf der Jazz- und-Lyrik-Tradition der 1950er-Jahre auf, erhielten durch die gesellschaftskritisch orientierte Underground-Musik von der amerikanischen Westküste aber neue Schubkraft und eine stärker politische Note.
10![]()
Begonnen hatte der „Siegeszug der Phonetik“ dem Journalisten Karl Otto Paetel zufolge ebenfalls in den 1950er-Jahren mit den amerikanischen Comics, deren Gefahr er nicht in erster Linie in ihrer inhaltlichen Tendenz sah, sondern in einer „Entfremdung vom Wort“. Die „Kapitulation vor der phonetischen Denkweise“ finde dort statt, wo eine „phonetische Schreibweise […] dem Kind ein völlig falsches Wortbild, d.h. in Wirklichkeit nur ein Lautbild“ vermittle.61 Die nachfolgende Dekade bestätigte diese Analyse nur zum Teil. Wie die Auflagensteigerungen bei Büchern, Zeitungen und Illustrierten in den 1960er-Jahren zeigten, verlief der Aufstieg der Lautlichkeit, wie er nirgends sichtbarer wurde als im Erfolg der Rockmusik, parallel zu einem Aufstieg des Wortes – kurz, in einer umfassenden Medialisierung. Dass hier mitunter auch die Fusion der als gegensätzlich konstruierten Pole bestimmend werden konnte, zeigt das Ineinandergreifen von Text und Sound bei Rockpoeten wie Bob Dylan und Leonard Cohen und bei Bands wie „Mothers of Invention“ oder „Ton Steine Scherben“.
Die wesentliche Basis der neuen Massenkultur, die um die Popmusik entstand, war der technische Fortschritt auf der Produktions- wie auch auf der Rezeptionsseite. Dass das hier sichtbare riesige Potenzial der Kulturindustrie nicht nur manipulativ wirkte, sondern auch eigensinnig genutzt werden konnte, zeigte sich an Beat- und Rockmusikern ebenso wie an den Rezeptionsweisen des Publikums, so dass Walter Benjamins Theorie vom revolutionären Gehalt des technisch reproduzierbaren Kunstwerks hohe Plausibilität zugemessen wurde – zumal sie auf eine „Politisierung der Kunst“ abzielte und auch damit dem Zeitgeist entsprach. Gleichzeitig entstanden in diesem neuen Schub der Massenkultur vielfältige Differenzierungen, die Individualisierung und Spezialisierung vorantrieben. Die Normierung der Klangqualität nach dem Maßstab hoher Wiedergabetreue spielte dabei eine wichtige Rolle. Dass das, was manche als „Lärm“ identifizierten, von anderen auf Schallplatten und Stereoanlagen in „High-Fidelity“-Qualität genossen wurde, deutet die große Spannweite der zeitgenössischen Wahrnehmungen und Deutungen ebenso an wie die enorm gewachsene Bedeutung des Klangs für die Empfindungswelt am Übergang zu einer „postindustriellen“ Gesellschaft.
Klänge und Bilder waren schon in den 1960er-Jahren eng miteinander verknüpft. Dies zeigen der Aufstieg von Musikillustrierten wie „Bravo“, „Musik Express“ oder „Popfoto“ ebenso wie derjenige der ersten Fernsehformate – allen voran Radio Bremens „Beat Club“ – und die große Resonanz von Musikfilmen etwa der Beatles. Der Erfolg filmischer Konzertdokumentationen zum Beispiel des Woodstock-Festivals (1970), der im Altamont-Konzert gipfelnden US-Tour der „Rolling Stones“ von 1969 („Gimme Shelter“, 1970) oder des Abschiedskonzerts von „The Band“ in San Francisco („The Last Waltz“, 1976) verweist auf das ausgeprägte Bedürfnis, die musikalische und körperliche Performance der Künstler umfassend und quasiauthentisch zu rezipieren – selbst wenn manche dieser Unternehmungen als kommerziell motiviert kritisiert wurden. Seit Ende der 1970er-Jahre wurde die Verbindung von Sounds und Visions durch Musikvideos zu einem Kernelement populärer Musikkultur, dem sich seit 1984 mit MTV Europe ein eigener TV-Kanal widmet. Während sich das Protestpotenzial des Rocksounds mit der Gewöhnung partiell verlor und einstmals als besonders rebellisch wahrgenommene Bands wie die „Rolling Stones“ oder „Mothers of Invention“ als erfolgreiche Akteure auf dem Rockmarkt mit dem Verdikt des Verrats bedacht wurden, entstanden immer neue Stile, die sich von einem jeweils erreichten „Mainstream“ absetzen wollten und etwas Neues hervorbrachten. Aus diesem nicht zuletzt kommerziell induzierten Zirkel von Abweichung und Erfolg gibt es kaum einen Ausweg. Er ist es, der die Innovationsspirale antreibt und immer neue Sounds erzeugt.
1 Helmut Salzinger, Das lange Gedicht, in: Vagelis Tsakiridis (Hg.), Super-Garde. Prosa der Beat- und Pop-Generation, Düsseldorf 1969, S. 167-191, hier S. 191.
2 Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York 1976, S. 122.
3 Vgl. die Zusammenschau von Bodo Mrozek, Popgeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6.5.2010.
4 Vgl. meine Versuche: Detlef Siegfried, Time Is on My Side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 60er Jahre, 2. Aufl. Göttingen 2008; ders., Sound der Revolte. Studien zur Kulturrevolution um 1968, Weinheim 2008. Programmatisch: Thomas Lindenberger, Vergangenes Hören und Sehen. Zeitgeschichte und ihre Herausforderung durch die audiovisuellen Medien, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 1 (2004), S. 72-85.
5 Vgl. zur DDR und zu Polen den Beitrag von Christian Schmidt-Rost in diesem Heft.
6 Zu kulturellen Praktiken beim Umgang mit audiotechnologischen Wiedergabegeräten vgl. Karin Bijsterveld/José van Dijck (Hg.), Sound Souvenirs. Audio Technologies, Memory and Cultural Practices, Amsterdam 2009.
7 Vgl. Stefan Gauß, Das Erlebnis des Hörens. Die Stereoanlage als kulturelle Erfahrung, in: Wolfgang Ruppert (Hg.), Um 1968. Die Repräsentation der Dinge, Marburg 1998, S. 65-93, hier S. 70f. Zu den technologischen Entwicklungen insgesamt: Mark Katz, Capturing Sound. How Technology has Changed Music, Berkeley 2010. Als zeitgenössische Reflexion des veränderten Hörens vgl. Rolf-Ulrich Kaiser, Rock-Zeit. Stars, Geschäft und Geschichte der neuen Pop-Musik, Düsseldorf 1972, S. 244f.
8 Funkfachhändler, 2. Oktober-Ausgabe 1968, S. 409.
9 So jedenfalls noch im Winter 1970/71; schon im September 1972 war Braun auch unter den Zwanzigjährigen stärker vertreten. Vgl. Spiegel-Verlag (Hg.), Männer und Märkte II. Besitz, Konsum- und Informationsverhalten der männlichen Bundesbevölkerung, Bd. 1-3, Hamburg o.J. [1971], Tab. 47; ders. (Hg.), KKK. Kauf-, Konsum- und Kommunikationsverhalten der Bundesbevölkerung, Bd. 4, Hamburg o.J. [1973], S. 47.
10 Ders. (Hg.), Männer und Märkte. Besitz, Konsum und Informationsverhalten der männlichen Bundesbevölkerung, Bd. 3, Hamburg o.J. [1969].
11 Vgl. auch die Befunde der Allensbach-Werbeträger-Analyse von 1973, derzufolge „Konkret“ und „Pardon“ in der Spitzengruppe jener Werbeträger rangierten, die besonders hohe Anteile „markenbewusster Kaufentscheider“ oder „Marktpioniere“ bei größeren Stereoanlagen, großen Tonbandgeräten oder Fotoapparaten aufwiesen (nicht zu vergessen andere Annehmlichkeiten wie Urlaub am Meer oder Auslandsreisen). Allensbacher Berichte, Nr. 31/1973.
12 Vgl. zur Definition Peter Wicke, Klang-Konfigurationen und Soundtechnologien, in: ders. (Hg.), Rock- und Popmusik, Laaber 2001, S. 23-41; Frank Schätzlein, Sound und Sounddesign in Medien und Forschung, in: Harro Segeberg/Frank Schätzlein (Hg.), Sound. Zur Technologie und Ästhetik des Akustischen in den Medien, Marburg 2005, S. 24-40; Susanne Binas-Preisendörfer, Rau, süßlich, transparent oder dumpf – Sound als eine ästhetische Kategorie populärer Musikformen. Annäherung an einen populären Begriff, in: Kaspar Maase (Hg.), Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrungen der Gegenwart, Frankfurt a.M. 2008, S. 192-209.
13 Vgl. Lothar Heinle, Anthems & Machine Guns: Jimi Hendrix und der Krieg in Vietnam, in: Annemarie Firme/Ramona Hocker (Hg.), Von Schlachthymnen und Protestsongs. Zur Kulturgeschichte des Verhältnisses von Musik und Krieg, Bielefeld 2007, S. 241-261.
14 Peter Wicke, Anatomie des Rock, Leipzig 1987, S. 132.
15 Binas-Preisendörfer, Sound als eine ästhetische Kategorie (Anm. 12), S. 199.
16 R. Murray Schafer, The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Rochester 1994, S. 114ff. Das Folgende ebd., S. 119.
17 Die gefallene Natur, in: Spiegel, 2.5.1966, S. 50-69, hier S. 50.
18 Twen, Nr. 3/1969, S. 52. Vgl. Peter Wicke, Rockmusik. Zur Ästhetik und Soziologie eines Massenmediums, Leipzig 1989, S. 142.
19 Berliner Morgenpost, 26.1.1966; Welt, 30.1.1966; Schierer Lärm, in: Spiegel, 24.1.1966, S. 66.
20 Holger Knudsen, Beat – Beat – Beat und die Gerichte, in: Recht der Jugend 14 (1966), S. 248ff.
21 Rolf-Ulrich Kaiser, Beatfestival in Recklinghausen, in: Deutsche Jugend 15 (1967), S. 104f., hier S. 104. Für München vgl. Thomas Kleinknecht/Michael Sturm, „Demonstrationen sind punktuelle Plebiszite“. Polizeireform und gesellschaftliche Demokratisierung von den Sechziger- zu den Achtzigerjahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 44 (2004), S. 181-218, hier S. 208.
22 Gerhard Potrykus, Zur Vergnügungssteuerpflicht für Beatveranstaltungen, in: Recht der Jugend und des Bildungswesens 16 (1968), S. 212ff., hier S. 213.
23 Star-Club (Bunkenburg) an Bezirkssteueramt Hamburg-Mitte, 21.2.1966, und Steueramt an Star-Club, 22.3.1966, beides in: Staatsarchiv Hamburg (im Folgenden: StAH), 442-1, 95.92-15/9, Bd. 4.
24 Star-Club (Bunkenburg) an Bezirkssteueramt Hamburg-Mitte, 22.9.1966, StAH, 442-1, 95.92-15/9, Bd. 6.
25 So zit. von Günter Zint nach dem Behördenschreiben aus Weißleders Hinterlassenschaft (Thorsten Schmidt [Hg.], Günter Zint. Portrait of Music, Bremen 1998, o. Pag.).
26 Finanzgericht Hamburg, Urteil, 12.8.1970, StAH, 442-1, 95.92-15/9, Bd. 8.
27 Dieter Baacke, Beat – die sprachlose Opposition, München 1968, S. 66; Peter Zimmermann, Aufwachsen mit Rockmusik – Rockgeschichte und Sozialisation, in: Ulf Preuss-Lausitz u.a., Kriegskinder, Konsumkinder, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, Weinheim 1983, S. 107-126, hier S. 120. Aus der zeitgenössischen Wahrnehmung vgl. exemplarisch Twen, Nr. 7/1968, S. 28, sowie Helmut Salzingers „Das lange Gedicht“ von 1969, das vor übersteuerten Verstärkern, schrillen Gitarren und der Revolution nur so heulte (siehe das diesem Aufsatz vorangestellte Zitat und den Nachweis in Anm. 1).
28 Vgl. die Einleitung von Wolfgang Kos und Thomas Mießgang zu Kunsthalle Wien/Gerald Matt/Thomas Mießgang/Wolfgang Kos (Hg.), Go Johnny Go. Die E-Gitarre – Kunst und Mythos, Wien 2003, S. 10ff.
29 Viggo Graf Blücher, Jugend, Bildung und Freizeit. Dritte Untersuchung zur Situation der Deutschen Jugend im Bundesgebiet, durchgeführt vom EMNID-Institut für Sozialforschung im Auftrag des Jugendwerks der Deutschen Shell, o.O. o.J. [1966], S. 29. Der Anteil derjenigen, die ein Instrument beherrschten (besonders die Gitarre), stieg bis 1984 auf 30 Prozent (Jürgen Zinnecker, Jugendkultur 1940–1985, hg. vom Jugendwerk der Deutschen Shell, Opladen 1987, S. 198).
30 Funkfachhändler, Nr. 7/1968, S. 140.
31 Die Demoskopie sprach im Ergebnis einer nichtrepräsentativen qualitativen Untersuchung über die Einstellung der Bevölkerung zur Elektrizität von einem „latent vorhandenen Elektrizitätsbewußtsein“ und einem „Zeitsymbol“ (Institut für Demoskopie, Allensbach, Beziehung zur Elektrizität, April 1966, Bundesarchiv Koblenz, Zsg. 132/1339).
32 Konkret, Nr. 2/1966, S. 24ff.
33 Twen, Nr. 5/1970, S. 99; Pardon, Nr. 9/1971, S. 40ff.
34 Vgl. aus der Vielzahl der Berichte die Zeitzeugenaussagen in: Horst-D. Mannel/Rainer Obeling, Beat-Geschichte(n) im Revier, Recklinghausen 1993, S. 107, S. 128, S. 171.
35 Oda Schaefer, Beatlemania, in: Melos 31 (1964), S. 334-401, hier S. 338.
36 Heinrich Grössel, Die Beat-Musik. Versuch einer Analyse, in: Neue Sammlung 7 (1967), S. 240-253, hier S. 242.
37 Nora M. Alter/Lutz Koepnick, Sound Matters. Introduction, in: dies (Hg.), Sound Matters. Essays on the Acoustics of Modern German Culture, New York 2004, S. 1-29, hier S. 5.
38 Baacke, Beat (Anm. 27), S. 74.
39 In dieser Hinsicht ebenso legendär, aber auch aufgrund ihrer Hautfarbe weniger polarisierend, waren „The Who“, deren Destruktionskunst nicht zuletzt eine akustische Komponente hatte. Vgl. aus der Presseberichterstattung: Musikparade, 8.5.1967. Zum Hintergrund: Wolfgang Kraushaar, Gitarrenzertrümmerung. Gustav Metzger, die Idee des autodestruktiven Kunstwerks und deren Folgen in der Rockmusik, in: Mittelweg 36 10 (2001) H. 1, S. 2-28.
40 Sounds, Nr. 12/1969, o. Pag.
41 Zeitzeugenaussage in: Dieter Beckmann/Klaus Martens, Star-Club, Reinbek bei Hamburg 1980, S. 136.
42 Vgl. Alter/Koepnick, Sound Matters (Anm. 37), S. 7.
43 Wie Anm. 40.
44 Zitat: Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente [1944], Frankfurt a.M. 1988, S. 129.
45 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [1936], in: ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt a.M. 1963 (u.ö.), S. 7-64.
46 Helmut Salzinger, Swinging Benjamin, Frankfurt a.M. 1973, S. 93. Das Folgende ebd., S. 107f. Vgl. auch schon ders., Rock Power oder Wie musikalisch ist die Revolution? Ein Essay über Pop-Musik und Gegenkultur, Frankfurt a.M. 1972, S. 230ff.
47 Salzinger, Swinging Benjamin (Anm. 46), S. 125.
48 Helmut Lethen, Über das Spiel von Infamien, in: Ulrich Ott/Roman Luckscheiter (Hg.), Belles Lettres/Graffiti. Soziale Phantasien und Ausdrucksformen der Achtundsechziger, Göttingen 2001, S. 53-66, hier S. 55.
49 Zu diesem Verhältnis vgl. den Überblick von Richard Langston, Roll Over Beethoven! Chuck Berry! Mick Jagger! 1960s Rock, the Myth of Progress, and the Burden of National Identity in West Germany, in: Alter/Koepnick, Sound Matters (Anm. 37), S. 183-196.
50 Als Klangbeispiele vgl. ihre Lieder „Fließbandbaby“ (1969) und „Ohne Dich“ (1970): <http://www.youtube.com/watch?v=8j8zGNOAvGI>.
51 Sounds, Nr. 17/1970, o. Pag., und Nr. 47/1973, S. 30.
52 Vgl. hier als Beispiel das Lied „Menschenjäger“ (1972): <http://www.youtube.com/watch?v=N5d3EyPad40>. Zitat aus dem Aufruf der Band „Musik ist eine Waffe!“, abgedruckt etwa in dem Vorstellungsflugblatt „Ton Steine Scherben“, in: Deutsches Kabarettarchiv (im Folgenden: DKA), Lx/Cc/3,7.
53 Zitat: Pan, Nr. 3/1971, S. 29. Vgl. die Präsentation der Band auf einem Flugblatt, das durch expressive Revolutionssymbolik – Stern, Regenbogen und Maschinenpistole – auf sich aufmerksam machte, in: DKA, Lx/Cc/3,7.
54 Holger Böning, Der Traum von einer Sache. Aufstieg und Fall der Utopie im politischen Lied der Bundesrepublik und der DDR, Bremen 2004.
55 Eckard Holler, The Folk and Liedermacher Scene in the Federal Republic in the 1970s and 1980s, in: David Robb (Hg.), Protest Song in East and West Germany since the 1960s, Rochester 2007, S. 133-167.
56 Adelheid Maske/Ulrich Maske, Das werden wir schon ändern. Franz Josef Degenhardt und seine Lieder, Dortmund 1977.
57 Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen. Alle Lieder von Franz Josef Degenhardt, München 1979, S. 83.
58 Schafer, Soundscape (Anm. 16), S. 115.
59 Binas-Preisendörfer, Sound als eine ästhetische Kategorie (Anm. 12), S. 204.
60 Vgl. Roman Luckscheiter, Der postmoderne Impuls. Die Krise der Literatur um 1968 und ihre Überwindung, Berlin 2001, S. 31ff., sowie das Kompendium von Johannes Ullmaier, Von Acid nach Adlon und zurück. Eine Reise durch die deutschsprachige Popliteratur, Mainz 2001, S. 48ff.
61 Karl O. Paetel, Der Siegeszug der Phonetik, in: Recht der Jugend 4 (1956), S. 257f.
Zum Weiterlesen:
Unsere ausführliche Bibliographie mit Büchern und Rezensionsnachweisen zum Themenkomplex »1968« (Publikationsjahre 2005–2018) finden Sie hier.