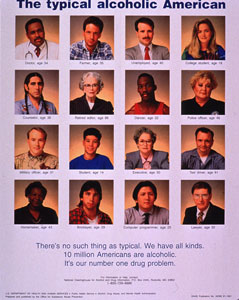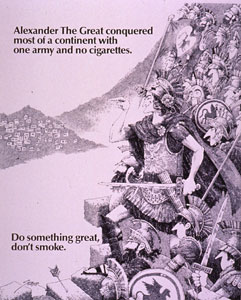Der Vorsorgegedanke gehört, im Gesundheitswesen und darüber hinaus, zu den grundlegenden Kulturtechniken der Moderne. Die neuere Medizinsoziologie hat die Entwicklung der Gesundheitsprävention als Teil eines institutionellen Umbruchs von einem Gesundheitswesen alten Typs (Old Public Health) zu einem System neuen Typs (New Public Health) interpretiert.1 Demzufolge ging die Gesundheitspolitik alten Stils primär von staatlichen Einrichtungen aus und versuchte spezifische Krankheiten bei entsprechenden Risikogruppen zu bekämpfen. Dagegen betonen Ansätze des New Public Health das Leitbild einer umfassenden, auf die Gesamtbevölkerung zielenden Gesundheitsförderung, machen aber zugleich das Individuum verstärkt für die Vorsorge verantwortlich.2 Mit dem neuen Präventionsregime verbinden sich gleichwohl erhöhte normative Ansprüche und ausgeweitete staatliche Regulierungen. Sie manifestieren sich etwa in Tabaksteuern und Rauchverboten oder in Forderungen nach neuen Impfzwängen (Gebärmutterhalskrebs), obligatorischen Vorsorgeuntersuchungen (Brustkrebs) oder fiskalischen Auflagen wie den in Dänemark oder Ungarn eingeführten Zucker- und Fettsteuern.3
Falsch wäre allerdings die Annahme, dass der Aufstieg der Prävention quasi teleologisch und linear erfolgt sei. Die Wahlverwandtschaft zwischen Vorsorge und Moderne (einschließlich der Krisen und Konjunkturen präventiver Orientierungen) muss im jeweiligen historischen Kontext erklärt werden. Eine Geschichte der Vorsorge muss also nach den gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen fragen, unter denen sich spezifische Präventionspraktiken herausbildeten. Diese Sicht ist in der bisherigen Forschung, die den Vorsorgegedanken vor allem als Teil der Sozialstaatsgeschichte oder als Organisationsgeschichte des Gesundheitswesens analysiert hat, noch unterentwickelt.
Für ein solches Vorhaben lässt sich an kulturanthropologische und kulturtheoretische Ansätze anknüpfen. Schon Mary Douglas hat darauf hingewiesen, dass gesellschaftliche Risikowahrnehmungen, die Präventionsmodellen unterlegt sind, eine identitäts- und gemeinschaftsbildende Funktion besitzen. Die Perzeption von Risiken ist gekoppelt an das Selbstverständnis der sich bedroht fühlenden Gruppen.4 Ein derartiger Ansatz eröffnet aufschlussreiche Fragestellungen, etwa nach den zeittypischen Normen- und Wertesystemen, die sich in Vorsorgedispositiven manifestierten. Generell haben sich sozial- und kulturanthropologische Zugänge in der neueren medizinhistorischen und -soziologischen Forschung als innovativ erwiesen.5
2![]()
Das Potential eines kulturhistorischen Zugangs wird im Folgenden exemplarisch ausgelotet – anhand der Debatten um die Prävention chronischer Krankheiten in den Vereinigten Staaten. Insbesondere Herzkreislauf- und Krebskrankheiten standen im Verlauf des 20. Jahrhunderts zunehmend im Fokus der präventivmedizinischen Diskussionen, anstelle der vormals bedeutenden epidemischen Krankheiten. Dieser Übergang zu einem auf chronische Krankheiten fokussierten Präventionsregime ist noch kaum erforscht. Gerade die USA bieten sich für eine solche Untersuchung an, weil sich die Sozial- und Präventivmedizin dort früh mit den Risikofaktoren chronischer Krankheiten auseinandergesetzt hat – vor allem mit dem Übergewicht, aber auch mit dem Tabak- und Alkoholkonsum.6
Präventionsregime folgen nationalstaatlichen Pfaden. So war in Großbritannien der Diskurs um die Zivilisationskrankheiten der Nachkriegszeit stark vom Tabakkonsum dominiert, während in anderen europäischen Ländern und in den USA eher die Sorge um Fett- und Fleischkonsum im Vordergrund stand.7 Leider mangelt es bislang noch an komparativen historischen Studien. Der begrenzte Rahmen des vorliegenden Beitrags lässt keinen umfassenden Vergleich zu, kann ausgehend von den USA aber einige Anregungen dafür liefern.
Der Essay gliedert sich in drei Abschnitte. Im ersten Teil wird die traditionelle Erklärung für den Aufstieg neuerer Präventionsregime im 20. Jahrhundert kritisch diskutiert. Der zweite Teil beleuchtet die historischen Grundzüge des US-amerikanischen Gesundheitswesens sowie seine Folgen für die Entwicklung des Präventionsdiskurses und führt in das Fallbeispiel ein. Im dritten Teil analysiere ich die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen, unter denen sich in den USA nach 1945 spezifische Präventionspraktiken entwickelt haben. Im Vordergrund steht die Debatte um Übergewicht, ergänzt durch knappe Hinweise auf die Auseinandersetzungen um Tabak- und Alkoholkonsum.
3![]()
1. Jenseits der epidemiologischen Transition:
Kritik des herkömmlichen Erklärungsmodells der Präventionsgeschichte
Die sozial- und medizinhistorische Forschung hat die Ausbreitung präventiver Dispositionen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lange Zeit auf die Veränderung der Krankheitsvorkommen zurückgeführt, die so genannte epidemiologische Transition. Demzufolge hatten die steigende Lebenserwartung in der westlichen Welt sowie der damit verbundene Übergang von übertragbaren zu chronischen und degenerativen Krankheiten (Krebs, Herzkreislaufkrankheiten oder Demenzerkrankungen) einen Bedarf an neuen medizinischen und gesundheitspolitischen Interventionsformen erzeugt. Während Infektionskrankheiten auf klar identifizierbare Erreger zurückgeführt wurden, schienen chronische Krankheiten nur durch ein multikausales Faktorenbündel erklärbar zu sein, das insbesondere Ernährungsrisiken oder Tabak- und Alkoholgenuss umfasste.8
Dieses Modell besitzt mehrere Schwächen. Erstens verlief die epidemiologische Transition keineswegs gradlinig. Fälle wie HIV oder die Vogelgrippe zeigen, dass Infektionskrankheiten weiterhin aktuell sind – nicht nur in Entwicklungs- und Schwellenländern, sondern auch in der westlichen Welt. Außerdem ist die Begrifflichkeit der epidemiologischen Wende inkohärent. Während das Konzept der Infektionskrankheiten auf einen Verursachungsmechanismus referiert, bezeichnen die Begriffe der chronischen und degenerativen Krankheiten einen Krankheitsverlauf. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach – etwa im Fall des Gebärmutterhalskrebses, der wie viele Krebserkrankungen lange zu den chronischen Krankheiten gerechnet wurde, bis er in den 1980er-Jahren auf eine Virusinfektion zurückgeführt wurde und seither als Infektionskrankheit gilt. Schließlich ist die Gefahr, die von chronischen Krankheiten ausgeht, umstritten. Im Falle von Adipositas und Übergewicht (zumindest bei leichteren Formen) ist unklar, ob damit wirklich ein substanzieller Anstieg der Sterblichkeit verbunden ist.9
Hinzu kommt, dass die öffentliche Wahrnehmung von Krankheitsrisiken nach 1945 nicht einfach den multifaktoriellen Erkenntnissen der medizinischen Risikoforschung entsprach. Die breite Öffentlichkeit verkürzte das Spektrum medizinisch identifizierter Risikofaktoren auf wenige pathogene Substanzen: die viel zitierte unheilige Trias von Alkohol, Tabak und Fett, die für Herzinfarkt, Krebs und Diabetes verantwortlich gemacht wurden.10 Diese reduzierte Risikowahrnehmung ist erklärungsbedürftig. Die Popularität der Risikofaktoren Fett, Tabak und Alkohol lässt sich nicht allein aus dem medizinischen Wissen um chronische Krankheiten erklären. Sie gründet vielmehr auf zeitspezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren, durch die bestimmte Risikoperzeptionen ihre Suggestivwirkung entfalteten.
4![]()
2. Von Mangelernährung zur Adipositas-Epidemie:
Gesundheitspolitische Debatten um Herzkreislauf-Risiken in den USA
Die USA sind weder ein bloß rudimentärer Wohlfahrtsstaat, noch besitzen sie ein ausgebautes Sicherungssystem europäischen Typs. Das Land hebt sich von europäischen Vergleichsbeispielen vielmehr durch qualitative Unterschiede ab. Seine Wohlfahrtsstaatsgeschichte ist geprägt von ausgebauten privaten Versicherungsprogrammen, einer dominierenden Stellung privater Akteure (der Versicherungsindustrie und berufsspezifischer Lobbygruppen) sowie einem geringen Maß fiskalisch finanzierter Leistungen und zentralstaatlicher Interventionen.
Für diesen Entwicklungspfad maßgeblich war die Zeit des New Deal. Mit dem Social Security Act entstand 1935 zwar ein bescheidenes staatliches Altersrentenprogramm. Die geplante staatliche Krankenversicherung scheiterte aber am Widerstand der Ärzteschaft und der Versicherungsbranche. Sowohl in der Kranken- als auch in der Rentenversicherung blieb der Spielraum für private Versicherungsmodelle groß, insbesondere für arbeitgeberfinanzierte berufliche Renten- und Krankenversicherungen. In der Krankenversicherung beschränkte sich der Bundesstaat seit dem New Deal darauf, die Ausbreitung der betrieblichen Kassen zu subventionieren. Dies hatte die paradoxe Folge, dass der Staat seine eigenen Sozialversicherungsprojekte letztlich torpedierte, indem er ein Parallelsystem privater Wohlfahrtseinrichtungen stärkte. Akteure wie die liberale, staatskritische Amerikanische Ärztevereinigung oder der Einfluss der Einzelstaaten trugen ebenfalls zur anti-etatistischen Linie bei. Vor diesem Hintergrund waren Projekte für eine staatliche Krankenversicherung seit den 1950er-Jahren nur noch als Ergänzung und nicht mehr als Ersatz privater Sicherungssysteme denkbar.11 Dieser Logik unterstanden sämtliche folgenden Reformen des amerikanischen Gesundheitswesens – von den ersten staatlichen Krankenversicherungsprogrammen (1965), die vor allem auf ökonomisch schwache Gruppen zielten (Medicare für Rentnerinnen und Rentner, Medicaid für Sozialhilfeempfänger), bis zum Krankenversicherungsgesetz der ersten Obama-Administration (2010).
Der Einfluss privater Akteure und das geringe Gewicht zentralstaatlicher Institutionen spiegeln sich auch in der Art und Weise, wie die amerikanische Gesellschaft seit den 1940er-Jahren die Risiken von Herzkreislaufkrankheiten und die Gefahren von Übergewicht diskutierte. Den Ausgangspunkt der steigenden Sorge um Übergewicht und Adipositas (obesity) bildete ein langfristiger Wandel der Ernährungssituation, der vor allem in die Nachkriegsjahrzehnte fiel und nicht nur die USA, sondern auch andere westliche Industrienationen erfasste. Bis zur Großen Depression war die Ernährungslage in den USA und anderen Industriestaaten von akuten Hungererfahrungen und Mangelsituationen geprägt. Mangelernährung blieb in den USA selbst in der zweiten Jahrhunderthälfte verbreitet, wenn auch beschränkt auf arme Bevölkerungsgruppen.12 Entsprechend waren die Ernährungswissenschaften bis in die 1940er-Jahre noch stark dem Paradigma der Unterernährung verhaftet. Milchprodukte und andere fetthaltige Nahrungsmittel erschienen als effiziente Form der Ernährung.13 Noch in den 1950er-Jahren galt die Devise, Unter- und Mangelernährung durch mehr Essen zu bekämpfen.14 Nach neuesten Berechnungen breitete sich Übergewicht allerdings schon nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg deutlich schneller aus als nach 1960.15 Trotzdem wurde es erst in den 1960er-Jahren gesellschaftlich breit problematisiert – zunächst als krankheitsfördernde Anomalie, seit den 1980er-Jahren auch als eigenständige Krankheit (Adipositas). Heute gilt bis zu einem Drittel der erwachsenen Bevölkerung der USA als fettleibig – ein weltweit einmaliger Wert.16
5![]()
„Foods that count“: Das Steak war zu Kriegs- und Nachkriegszeiten ein Signum von Wohlstand und gesunder Ernährung. Aufklärungsplakat des U.S. Public Health Service (1942)
(National Library of Medicine)
Seit einigen Jahren hat sich die Problemwahrnehmung der Adipositas nochmals verschärft. Der Anstieg der neuen Pathologien verlief so steil, dass man in medizinischen Fachkreisen bisweilen von einer neuen Seuche, der Adipositas-Epidemie (obesity epidemic), zu sprechen begann. Die Diagnose Übergewicht wurde in den letzten Jahren gar zur gesellschaftlichen Normalität. Das „TIME Magazine“ erklärte 2004 zum „Jahr des Übergewichts“ und erhob die pathogene Anomalie gleichsam zum Kennzeichen der amerikanischen Gegenwartsgesellschaft.17 Heute soll es in den USA mehr Übergewichtige als Einkommenssteuerpflichtige geben, wobei Übergewicht zumindest als Vorstufe einer Adipositas-Erkrankung gilt, teilweise gar als eigenständige Krankheit.18 Besorgte Stimmen sehen gar die epidemiologische Weltordnung auf den Kopf gestellt. Wegen der neuen Zivilisationskrankheiten würden die westlichen Industrienationen bald ungesünder leben als die Bevölkerung der „Dritten Welt“.19
3. Risikodebatten als Zivilisations- und Konsumkritik
Wie ist die zunehmende Sorge um Übergewicht und Adipositas kulturhistorisch zu deuten? Ich möchte im Folgenden anregen, die Wahrnehmung von Ernährungs- und Gesundheitsrisiken als zeittypische Stigmatisierung emblematischer Konsumprodukte der Nachkriegszeit – Fleisch, Zigaretten, alkoholische Getränke – und damit auch als verdeckte Zivilisationskritik zu lesen. In den USA breiteten sich konsumgesellschaftliche Lebensstile seit der Zwischenkriegszeit stark aus. Luxus- und Genussmittel, die bis dahin den Oberschichten vorbehalten waren, wurden nun auch unter den neuen Mittelschichten üblich. Deren Statusgewinn spiegelte sich symbolhaft im häufigeren Zigarettenkonsum oder im täglichen Kotelett auf dem Teller. Entsprechend nahm in den USA der Fleischkonsum während der 1960er-Jahre um nicht weniger als ein Drittel zu, nachdem er seit dem frühen 20. Jahrhundert einigermaßen stabil geblieben war. Ermöglicht wurde dieser Prozess durch eine seit den 1930er-Jahren stark expandierende Nahrungs- und Genussmittelindustrie, verbunden mit im Verhältnis zur Kaufkraft sinkenden Lebensmittelpreisen.20
Ab dem Ende der 1950er-Jahre artikulierten sich jedoch zunehmend kritische Stimmen, die vor allem auf die Risiken der industriellen Nahrungsmittelproduktion aufmerksam machten. In kurzen Abständen erlangten mehrere Nahrungsmittelskandale eine breite Publizität. 1958 warnte das National Cancer Institute vor einer Reihe krebserregender chemischer Nahrungsmittelzusätze. Anfang der 1960er-Jahre verlagerte sich der Blick auf die Gefahren von Pestiziden, die in der Agrarwirtschaft breit eingesetzt wurden. 1962 erschien Rachel Carsons Buch „Silent Spring“, das eine breite Debatte um die schädlichen Folgen des DDT-Einsatzes in der amerikanischen Landwirtschaft auslöste.21 Im selben Jahr setzte eine nachhaltige Diskussion um die Gesundheitsrisiken von Cholesterin ein, angestoßen durch die Framingham-Studie, eine epidemiologische Langzeituntersuchung von Herzkreislauf-Erkrankungen. Vormals für gesund erachtete Grundnahrungsmittel – Milch, Butter, Käse, auch Rindfleisch – stellten sich plötzlich als bedenklich heraus. Vor allem die industrielle Fleischproduktion und der unüberlegte Fleischkonsum galten zunehmend als gesundheitsgefährdend (wobei der Konsum insgesamt weiterhin anstieg). In diesen Jahren konstituierte sich in den USA auch die moderne Konsumenten- und Gesundheitsbewegung. Die ersten Prozesse von Ralph Nader und seinen Mitstreitern begannen 1967, bezeichnenderweise gegen die Fleischindustrie.22
6![]()
In den zunehmenden Ängsten vor Nahrungsmittelrisiken manifestierte sich eine verbreitete Kritik an der Industrialisierung und Modernisierung der Ernährung – und generell an konsumgesellschaftlichen Lebensstilen. Pathologisierte Substanzen wie Tabak, Alkohol und Fett verkörperten symbolhaft die Konsumorientierungen der neuen Mittelschichten.23 Wer auf die konsumgesellschaftlichen Verheißungen zu verzichten bereit war, schien sich erfolgreich gegen die Pathologien der Moderne zu schützen. Dieser Diskurs knüpfte an andere, teilweise ältere kulturelle Leitbilder und Stigmatisierungen an – etwa an die Schlankheitsideale, wie sie in Frauenzeitschriften der 1950er- und 1960er-Jahre popularisiert wurden, oder an die in den USA besonders einflussreiche Alkoholkritik der Abstinenz- und Prohibitionsbewegung.24
„The typical alcoholic American“: Verbreitete konsumgesellschaftliche Lebensstile als Gesundheitsrisiko. Aufklärungsplakat der U.S. National Institutes of Health (1991)
(National Library of Medicine)
Die Sorgen um die neuen Gesundheitsrisiken waren und sind außerdem geprägt von der weitreichenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens und insofern verbunden mit einer subjektivierten Verantwortung für präventives Handeln. Die privaten Akteure – vor allem Versicherungs-, Pharma-, Tabakindustrie sowie private Krankenversicherer und Spitäler – verfolgten in den Debatten um die Risiken von Nahrungs- und Genussmitteln allerdings unterschiedliche Interessen. Die Lebensversicherungsbranche hatte beispielsweise schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert Techniken zur Bewertung von Menschenleben entwickelt, die die späteren gesundheitspolitischen Instrumente zur Risikobemessung teilweise vorwegnahmen. So wurde der Body-Mass-Index, der seit den 1960er-Jahren als Standardindikator zur Abgrenzung zwischen Übergewicht und krankhafter Fettsucht dient, um 1900 in amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaften entwickelt, um das Sterberisiko eines Versicherungskandidaten einzuschätzen und davon ausgehend einen Risikozuschlag auf seine Prämie zu berechnen.25
Zugleich wehrten sich Industrievertreter, insbesondere die Nahrungsmittel- und die Tabakindustrie, erfolgreich gegen eine pauschale Stigmatisierung ihrer Produkte. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden die Forderungen nach einem verstärkten Konsumenten- und Gesundheitsschutz wiederholt von big business torpediert.26 Die Eisenhower-Administration blockierte unter dem Einfluss von Industrievertretern bis Ende der 1950er-Jahre jegliche Gesetzesvorschläge, die die Nahrungsmittelindustrie verpflichtet hätten, chemische Nahrungsadditive auf Gesundheitsrisiken zu testen.27 In den 1970er-Jahren wurden Empfehlungen der Regierung für einen reduzierten Fleisch- und Fettkonsum durch den Kongress verhindert, ebenfalls nach Interventionen der Nahrungsmittelindustrie.28 Vergleichbares lässt sich für die Debatten um den Tabakkonsum festhalten. Die Tabakindustrie, eine der schlagkräftigsten Lobbys der USA, wehrte sich in den 1950er- und 1960er-Jahren erfolgreich gegen eine Regulierung des Rauchens, nicht zuletzt durch Sponsoring industriefreundlicher wissenschaftlicher Forschung.29
7![]()
Die Abwehrhaltung der Industrievertreter hatte allerdings nicht zur Folge, dass die Präventionsziele vollständig scheiterten. Sie verlagerten sich vielmehr auf die Ebene des Individuums. Bei allen drei Risiken – Ernährung, Tabak und Alkohol – etablierte sich seit den 1960er-Jahren eine Art Präventionskompromiss zwischen Staat und Privatwirtschaft. Konkret manifestierte sich diese Politik meist in Aufklärungskampagnen über Gesundheitsrisiken und in öffentlichen Appellen an die Vernunft der Konsumentinnen und Konsumenten. Die Tabakindustrie etwa musste ab Mitte der 1960er-Jahre Warnhinweise auf die Zigarettenverpackungen drucken, um Käuferinnen und Käufer über die Risiken des Rauchens zu informieren. Auch im Hinblick auf Cholesterinrisiken und den Alkoholkonsum blieb es weitgehend bei aufklärungsorientierten Aktionen wie produktbezogenen Deklarationspflichten, ohne prohibitive Interventionen des Staats.30 Der Politik konnte ein subjektiviertes Präventionsregime nur recht sein. In einem dezentral und liberal verfassten Gesundheitswesen wie jenem der USA war eine direkte staatliche Intervention ins Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern politisch ohnehin chancenlos. Als individualisierte Verhaltenserwartung ließen sich Präventionsziele hingegen losgelöst von staatlichen Kompetenzausweitungen oder Markteingriffen formulieren.
„Do something great“: Alexander der Große und Christoph Kolumbus als Vorbilder einer subjektivierenden Präventionskampagne. Aufklärungsplakat des U.S. Dept. of Health Human Services (o.J.)
(National Library of Medicine)
In diesem Zusammenhang sind auch zivilgesellschaftliche Vorsorgediskurse zu nennen, die sich ebenfalls bereits in den ersten Nachkriegsjahrzehnten ausbreiteten. Sie sind bislang noch kaum untersucht worden. Wichtige Impulse gingen von Patientenorganisationen und medizinischen Selbsthilfegruppen aus. Organisationen wie die Weight Watchers oder die Anonymous Alcoholics stellten schon früh das Subjekt ins Zentrum ihrer Aktivitäten. Dies manifestierte sich etwa in halböffentlichen Beichtritualen und kollektiv inszenierten Formen der Selbsterziehung innerhalb dieser Gruppen. Die chronischen Krankheiten wurden damit als „Willenskrankheiten“ codiert, gegen die nur individuelle Selbstkontrolle helfe. Ein solcher subjektorientierter Ansatz fand seit den 1970er-Jahren auch auf internationaler Ebene verstärktes Echo. Gesundheitspolitische Programme wie die WHO-Deklarationen von Alma Ata (1978/79) oder Ottawa (1986) setzten den Akzent zunehmend auf die individuelle Gesundheitsförderung. Eine gesellschaftliche Breitenwirkung konnten solche Ansätze aber nur begrenzt entfalten. Dies nicht zuletzt aus ökonomischen Gründen: Fettreiche Ernährung ist bis heute oft kostengünstiger als fettarme Produkte. Die Betonung individueller „Willensstärke“ lenkt häufig von Fragen sozialer Ungleichheit ab, die im Kontext der Gesundheitsvorsorge ebenfalls zu diskutieren wären.
Aus europäischer Sicht sollte man die dargestellten Entwicklungen nicht einfach als amerikanischen Sonderweg abhaken; sie lassen sich auch in den europäischen Ländern verfolgen. Gerade der Ernährungsbereich verweist auf eine Reihe paralleler Entwicklungs- oder gar Amerikanisierungstendenzen. Dies betrifft etwa die materielle Ernährungssituation. Die westeuropäischen Länder erlebten einen ähnlichen Übergang von Mangelernährungsphasen, die bis Ende der 1940er-Jahre reichten, zu einer verbreiteten Überernährung seit den 1950er-Jahren. Die Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion und die konsumgesellschaftliche Transformation der Ernährungsstile verliefen in Westeuropa ebenfalls parallel zu denen in den USA oder wurden durch diese inspiriert. Spätestens seit 1989/90 haben entsprechende Ernährungsgewohnheiten auch die osteuropäischen Staaten erfasst. Vergleichbar ist schließlich die Kritik an bestimmten Ernährungsstilen. Wie die USA erlebte auch Westeuropa in den 1960er-Jahren eine Ernüchterung gegenüber den Heilsversprechen der Ernährungswissenschaften und der Nahrungsmittelindustrie. Frühe Lebensmittelskandale wie der Fall gesundheitsschädigenden Margarine-Produkte, der 1960 die deutsche und niederländische Öffentlichkeit beschäftigte, oder die spätere Sorge um cholesterinhaltige Nahrungsmittel führten auch in Westeuropa dazu, dass der Konsum von Milchprodukten und Fleisch zunehmend problematisiert wurde. Die Parallelen lassen sich bis in die jüngste Zeit hinein verfolgen. So zielt auch die Gesundheitspolitik der Europäischen Union darauf, die Verantwortung der einzelnen Subjekte zu stärken, etwa durch Ausbau der Patientenrechte oder durch europaweite Aufklärungskampagnen.31 All dies zeigt: Trotz der organisatorischen Differenzen zwischen amerikanischen und westeuropäischen Gesundheitssystemen befinden sich beide Seiten qualitativ auf demselben vorsorgepolitischen Pfad.
1 Die Begriffe „Prävention“ und „Vorsorge“ werden im Folgenden synonym verwendet. Vgl. allgemein: Dorothy Porter (Hg.), Social Medicine and Medical Sociology in the Twentieth Century, Amsterdam 1997; Martin Lengwiler/Jeannette Madarász, Präventionsgeschichte als Kulturgeschichte der Gesundheitspolitik, in: dies. (Hg.), Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik, Bielefeld 2010, S. 11-28.
2 Exemplarisch: Theodore H. Tulchinsky/Elena A. Varaikova, The New Public Health, London 2009, S. XXIII; kritisch: Alan Petersen/Deborah Lupton, The New Public Health. Health and Self in the Age of Risk, London 1996.
3 Keith Wailoo u.a. (Hg.), Three Shots at Prevention. The HPV Vaccine and the Politics of Medicine’s Simple Solutions, Baltimore 2010; Robert A. Aronowitz, Unnatural History. Breast Cancer and American Society, Cambridge 2007.
4 Mary Douglas/Aaron Wildavsky, Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers, Berkeley 1982, S. 7-15; Mary Douglas, Risk and Blame. Essays in Cultural Theory, Milton Park 1992, S. 10-16.
5 Exemplarisch: Kirsten Bell/Darlene McNaughton/Amy Salmon (Hg.), Alcohol, Tobacco and Obesity. Morality, Mortality and the New Public Health, London 2011; Deborah Lupton, Fat, London 2013; für den deutschsprachigen Raum vgl. etwa Jörg Niewöhner/Christoph Kehl/Stefan Beck (Hg.), Wie geht Kultur unter die Haut? Emergente Praxen an der Schnittstelle von Medizin, Lebens- und Sozialwissenschaft, Bielefeld 2008; Jakob Tanner, Lebensmittel und neuzeitliche Technologien des Selbst. Die Inkorporation von Nahrung als Gesundheitsprävention, in: Lengwiler/Madarász, Das präventive Selbst (Anm. 1), S. 31-54.
6 Vgl. Robert A. Aronowitz, Making Sense of Illness. Science, Society, and Disease, Cambridge 1998, S. 111-165.
7 Virginia Berridge, Marketing Health. Smoking and the Discourse of Public Health in Britain, 1945–2000, Oxford 2007; Douglas/Wildavsky, Risk and Culture (Anm. 4), S. 10f.
8 Exemplarisch: Paul Weindling, From Infectious to Chronic Diseases. Changing Patterns of Sickness in the Nineteenth and Twentieth Century, in: Andrew Wear (Hg.), Medicine in Society, Cambridge 1992, S. 303-316; kritisch: Josef Ehmer, Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie: 1800–2000, München 2004, S. 118-127.
9 Zur Debatte vgl. Lupton, Fat (Anm. 5), S. 19f.; vgl. auch Avner Offer, Body Weight and Self-Control in the United States and Britain since the 1950s, in: Social History of Medicine 14 (2001), S. 79-106, hier S. 80.
10 Kirsten Bell/Darlene McNaughton/Amy Salmon, Introduction, in: dies., Alcohol, Tobacco and Obesity (Anm. 5), S. 1-16, hier S. 1-4. Der Zucker besaß lange eine einflussreiche agrarpolitische Lobby und wurde in vielen Ländern erst seit den 1980er-Jahren zum pathogenen Risiko umgedeutet. Vgl. Maya Joseph/Marion Nestle, Food and Politics in the Modern Age: 1920–2012, in: Amy Bentley (Hg.), A Cultural History of Food in the Modern Age, London 2012, S. 87-110, hier S. 100f.
11 Jacob C. Hacker, The Divided Welfare State. The Battle over Public and Private Social Benefits in the USA, Cambridge 2002, S. 179-189; Daniel Béland, Social Security. History and Politics from the New Deal to the Privatization Debate, Lawrence 2006; Jennifer L. Klein, For all these Rights. Business, Labor, and the Shaping of America’s Public-Private Welfare State, Princeton 2003, S. 344-419.
12 Peter J. Atkins, Food Security, Safety, and Crises: 1920–2000, in: Bentley, A Cultural History of Food (Anm. 10), S. 69-86, hier S. 70f.
13 Mit Blick auf die internationalen Agenturen wie das International Institute of Agriculture (die spätere FAO) und das Gesundheitskomitee des Völkerbunds: Josep L. Barona, The Problem of Nutrition. Experimental Science, Public Health and Economy in Europe, 1914–1945, Brüssel 2010, S. 27-38, S. 70-86.
14 Joseph/Nestle, Food and Politics (Anm. 10), S. 95-102.
15 John Komlos/Marek Brabec, The Transition to Post-Industrial BMI Values in the United States, in: Avner Offer/Rachel Pechey/Stanley Ulijaszek (Hg.), Insecurity, Inequality, and Obesity in Affluent Societies, Oxford 2012, S. 141-159, hier S. 141-144.
16 Ebd., S. 141f.
17 Michael D. Lemonick, The Year of Obesity, in: TIME Magazine, 19.12.2004.
18 The Economist, 23.1.2010, S. 43; gezählt wurden Einkommenssteuerpflichtige auf Bundesebene (federal income tax).
19 Lupton, Fat (Anm. 5), S. 3ff.; Bell/McNaughton/Salmon, Introduction (Anm. 10), S. 1f.
20 Roger Horowitz, Putting Meat on the American Table. Taste, Technology, Transformation, Baltimore 2006, S. 12-15.
21 Vgl. Christof Mauch, Blick durchs Ökoskop. Rachel Carsons Klassiker und die Anfänge des modernen Umweltbewusstseins, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 9 (2012), S. 156-160.
22 Detlef Briesen, Das gesunde Leben. Ernährung und Gesundheit seit dem 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2010, S. 247-257.
23 Vgl. auch Avner Offer u.a., die den strukturellen Anstieg von Stresssituationen für die Ausbreitung der Adipositas in den USA nach 1945 verantwortlich machen und dies – etwas zu pauschal – mit marktliberalen Traditionen begründen: Avner Offer/Rachel Pechey/Stanley Ulijaszek, Obesity under Affluence Varies by Welfare Regimes, in: dies., Insecurity, Inequality, and Obesity (Anm. 15), S. 199-223, hier S. 210-214.
24 Offer, Body Weight and Self-Control (Anm. 9), S. 80; Bell/McNaughton/Salmon, Introduction (Anm. 10), S. 4f.; Mark Edward Lender/James Kirby Martin, Drinking in America. A History, London 1992, S. 182-195.
25 Sander Gilman, Obesity. The Biography, Oxford 2010, S. Xff.; Derek J. Oddy/Peter J. Atkins, Introduction, in: dies./Virginie Amilien (Hg.), The Rise of Obesity in Europe. A Twentieth Century Food History, Farnham 2009, S. 1-14, hier S. 6f.; Komlos/Brabec, The Transition to Post-Industrial BMI Values (Anm. 15).
26 Komlos/Brabec, The Transition to Post-Industrial BMI Values (Anm. 15), S. 155f.
27 Briesen, Das gesunde Leben (Anm. 22), S. 247-250.
28 Joseph/Nestle, Food and Politics (Anm. 10), S. 100f.
29 Robert N. Proctor, Golden Holocaust. Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition, Berkeley 2011, S. 253-481. Auch wenn der im Titel postulierte Holocaust-Vergleich abwegig ist, bietet Proctors Studie eine wertvolle Analyse des Einflusses der Tabakindustrie auf die amerikanische Gesundheitspolitik.
30 Ebd., S. 289-339; Lender/Martin, Drinking in America (Anm. 24), S. 189-195.
31 Scott L. Greer, The Politics of European Union Health Policies, Maidenhead 2009, S. 35-40.![]()