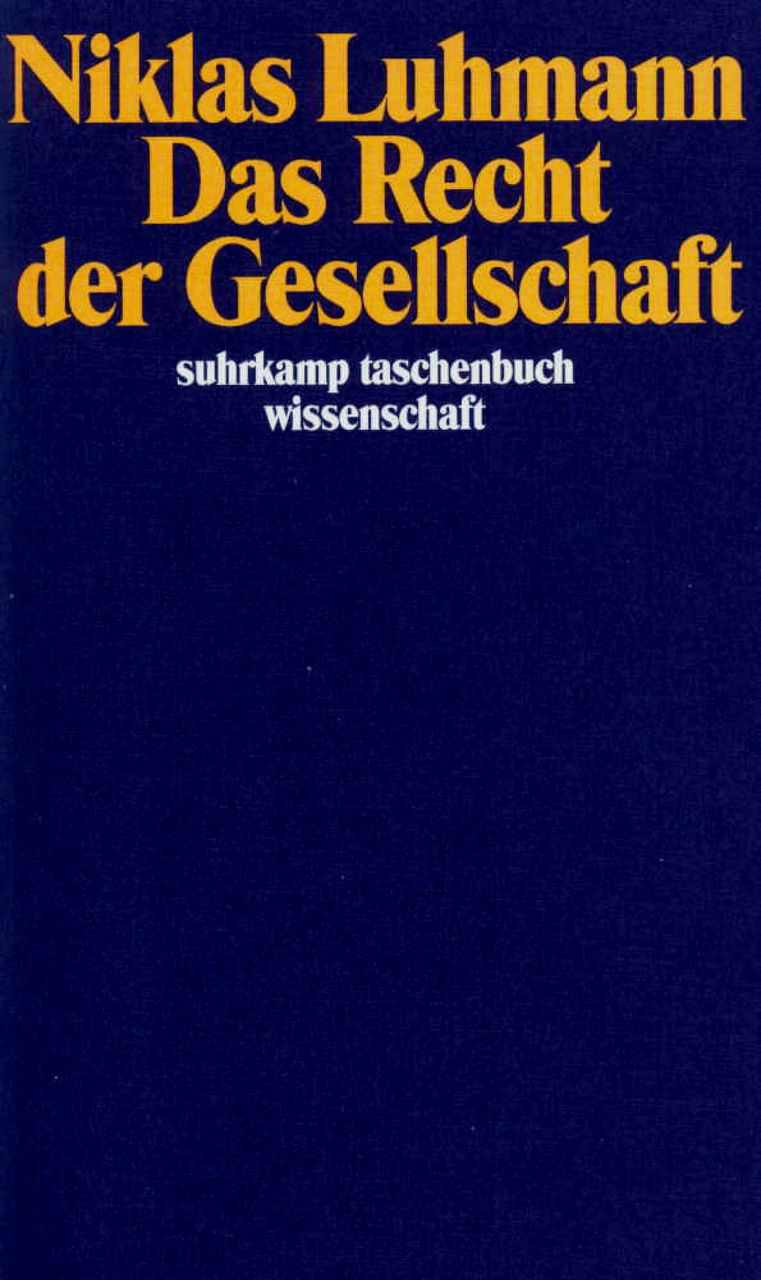Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993, 6. Aufl 2013;
zahlreiche Übersetzungen.
Es gibt zahlreiche Gelegenheiten, um festzustellen, dass auch das eigene Selbst – entgegen jeglicher irrationalen Hoffnung – dem Alterungsprozess nicht entzogen ist. Eine Möglichkeit ist die Aufforderung, gut 25 Jahre nach seinem ersten Erscheinen ein Buch zu thematisieren, dessen Erstauflage in der eigenen akademischen Ausbildung nicht ganz unbedeutend war. Es war 1997, als mit Niklas Luhmanns »Gesellschaft der Gesellschaft« ein in mehrerlei Hinsicht schwergewichtiger Block mitten in die allgemeine Theoriediskussion hineinplumpste. Dass dieses Buch in der Erstausgabe mit schwarzem Einband daherkam, erschien mir damals durchaus folgerichtig und erinnerte an den gleichfarbigen Monolithen aus Stanley Kubricks »2001: A Space Odyssey«. Ähnlich Ehrfurcht gebietend gestaltete sich die Lektüre von Luhmanns Hauptwerk, vor allem dem Novizen in Sachen Systemtheorie, der ich damals war.
Im geschichtswissenschaftlichen Studium spielten Hinführungen zu theoretischen Ansätzen welcher Art auch immer damals (wie heute) eine eher marginale Rolle. Umso dankbarer war ich, als Doktorand am Frankfurter Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in eine Einrichtung aufgenommen worden zu sein, an der eine erkleckliche Anzahl von Menschen unterwegs war, die sich für theoretische Fragen verschiedener Couleur interessierten. Zwei größere Fraktionen waren dabei auszumachen: einerseits die Poststrukturalist*innen, andererseits die Systemtheoretiker*innen. Beide Seiten nahmen sich (zumindest an diesem Ort) wechselseitig wohlwollend wahr.
Meine eigene Präferenz neigte in die poststrukturalistische Richtung, weil mir hier für historische Fragen mehr Spielraum zu existieren schien. Die Skepsis, die ich gegenüber der Systemtheorie in ihrer Bielefelder Ausformung hegte, machte sich zunächst als unbestimmter Eindruck bemerkbar: Mir ging das alles zu glatt auf. Ich hegte ein grundsätzliches Misstrauen gegen einen theoretischen Ansatz, der alles restlos verspeisen konnte, was man seiner begrifflichen Maschinerie zum Fraß vorwarf. Das historische Material, mit dem ich mich beschäftigte – vor allem Normen und Gerichtsprotokolle aus der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts – gab mir hingegen immer wieder zu verstehen: Die Verhältnisse, sie sind nicht so. Vor allem verhielten sie sich nicht so eindeutig, wie es mir die Systemtheorie weismachen wollte.
Doch gleichzeitig konnte (und kann) ich mich der Faszination des schimmernden Luhmann’schen Monolithen nicht entziehen. Als er mitten hineinfiel in meine Promotionszeit, wurde er unter Jurist*innen und Rechtshistoriker*innen aufmerksam rezipiert. Beim Autor handelte es sich schließlich um einen der Ihren, der Jura studiert, ein Referendariat absolviert und als Verwaltungsbeamter gearbeitet hatte. Und 1993 hatte Luhmann das Buch vorgelegt, um das es hier gehen soll: »Das Recht der Gesellschaft«.
Autobiographische Reminiszenzen sind an dieser Stelle aber nicht von Belang. Eher ist die Beschreibung einer Stimmung relevant, wie sie zumindest in manchen Kreisen und Diskussionszirkeln gegen Ende der 1990er-Jahre herrschte, wenn es um Verlautbarungen aus der schier unerschöpflichen und ungemein produktiven Theorie-Fabrik Luhmann ging. Man erwartete sich von diesem Theorie-Entwurf, der erkennbar seiner Vollendung entgegenstrebte, Antworten auf die ganz großen Fragen – auch und gerade unter denjenigen, die sich mit Themen des Rechts beschäftigten.
Wenn Luhmann in »Das Recht der Gesellschaft« das Problem aufwarf, dass es einen Unterschied mache, ob man das Rechtssystem von außen als Soziologe oder von innen als Jurist betrachte (S. 16f.), stellt sich die biographische Frage, welche Position er selbst dabei einnahm. Wohl diejenige des Soziologen. Aber konnte er den Juristen ganz ausblenden? Es ist gerade die Behandlung des Funktionssystems Recht, die zu biographischen Fragen einlädt. Denn dieses Recht war ein nicht unerheblicher Teil seines Lebens. Er war als Jurist ausgebildet worden, und seine frühen wissenschaftlichen Arbeiten waren wesentlich juristisch geprägt.1 Man kann sogar Argumente dafür finden, dass die Systemtheorie sich wesentlich juristischen Grundlagen verdankt.
Aber ist es gestattet, irgendeine von Luhmanns Arbeiten unter biographischen Gesichtspunkten zu lesen? Im Gegensatz zu manch anderen einflussreichen Theoretiker*innen des 20. Jahrhunderts ist in Luhmanns Fall die Kopplung von Lebenslauf und Arbeitsfortschritt in der Rezeption kein besonders prominentes Thema. Als biologisch-psychisches System kommt Luhmann selbst in seinen eigenen Arbeiten nur am Rande vor. Andere waren da autobiographisch exhibitionistischer.
Sein äußerer Lebenslauf (1927–1998) gibt auf den ersten Blick auch nicht viel her, um eine solche Kopplung zu legitimieren. Ab 1968 bis zum Lebensende Bielefeld. Davor zeigt sich das Territorium von Nordniedersachsen bis Westfalen als Luhmann-Land: Kindheit und Jugend in Lüneburg, ebendort eine mehrjährige Tätigkeit als Jurist am Oberverwaltungsgericht,2 Arbeit beim niedersächsischen Kultusministerium in Hannover, Promotion und Habilitation in Münster. Ausbrüche aus diesem regionalen Zusammenhang stellen das Studium in Freiburg, ein Forschungsaufenthalt in Harvard und die Referententätigkeit an der Verwaltungshochschule in Speyer dar. Nicht gerade eine filmreife Biographie.
Es gibt wohl nur wenige Autor*innen wissenschaftlicher Literatur, die als Personen derart hinter der kristallinen Oberfläche ihrer Theorie und ihrer Texte verschwinden. Luhmanns Name steht weniger für eine Biographie – und das als Zeitgenosse eines Jahrhunderts, in dem man ohne größere Schwierigkeiten oder eigenes Zutun zum Spielball übermächtiger Gewalten werden konnte –, sondern nahezu exklusiv für eine Theorie. Luhmann selbst hat zu diesem Umstand einiges beigetragen. Schließlich hat er mit einer Konsequenz, vielleicht muss man sogar sagen: mit einer Radikalität ein theoretisches Programm nicht nur formuliert, sondern auch umgesetzt, die ihresgleichen sucht. Kondensiert findet sich dies in der bekannten Einleitungspassage aus »Die Gesellschaft der Gesellschaft«, wonach sein Forschungsvorhaben in einer Theorie der Gesellschaft bestehe, 30 Jahre in Anspruch nehme und keine Kosten verursache.3
Liest man die Ergebnisse dieses schon 1969 angekündigten und so eindrücklich realisierten Vorhabens, dann ergibt sich eine seltsame Mischung aus gänzlicher Vorhersehbarkeit und freudigen Überraschungen. Es ist immer dasselbe und doch jedes Mal anders. Man kennt die zentralen Stichworte zur Genüge – Differenz, Autopoiesis, System-Umwelt-Relation etc. –, sodass man fast den Eindruck haben muss, Luhmann sei eine Art biologischer Algorithmus gewesen, der im Akkord Bücher schreiben konnte nach dem einmal festgelegten Schema. Man kann sich mit Blick auf Theorie- und Sprachduktus nicht ganz des Eindrucks erwehren, es sei weniger Luhmann, der hier spreche, sondern als habe sich die Systemtheorie Luhmanns als Sprachrohr bedient, um dank dieses Propheten in vollendeter Gestalt zur Welt zu kommen.
Und doch sind sie unverwechselbar, diese Texte, weil Luhmann nicht nur seiner eigenen Poetik und seinem eigenen Humor folgte, sondern weil er mit seinen Mitteln aus den behandelten Gegenständen immer wieder neue Funken zu schlagen verstand. Insbesondere bei der Lektüre von Luhmanns Vorlesungen4 kann man einen anderen, recht lebendigen Eindruck von den theoretischen Entscheidungen und auch Unsicherheiten erhalten, die in den stärker durchgearbeiteten Texten dann zu einer glasklaren, gleichzeitig überzeugenden und einnehmenden, aber immer auch hermetisch abweisenden Theoriesprache geführt haben.
In »Das Recht der Gesellschaft« werden die üblichen Verdächtigen der Systemtheorie ebenfalls aufgerufen. Ausgehend von rechtstheoretischen Grundannahmen kümmerte sich Luhmann um operative Geschlossenheit, Funktion, Codierung, Kontingenz, Evolution, strukturelle Kopplung, Selbstbeschreibung sowie um Gerichte, juristische Argumentation und das Verhältnis von Politik und Recht. Mit Blick auf geschichtswissenschaftliche Fragen lohnt sich die Lektüre dieses Buches möglicherweise in zweifacher Hinsicht. Erstens lässt sich überlegen, welche Rolle Luhmann dem Recht in einer »modernen«, funktional differenzierten Gesellschaft zumaß; und zweitens lässt sich, ganz parasitär, die Frage aufwerfen, wie die Geschichtswissenschaft von Luhmanns Rechtssystemtheorie profitieren könnte.5
Nun muss man sich bekanntermaßen im systemtheoretischen Zusammenhang auf einige Prämissen einlassen, um von diesem Ansatz profitieren zu können. Wenn Luhmann feststellte, dass es sich nicht mehr lohne, die Frage nach der Natur oder dem Wesen des Rechts zu stellen, sondern dass allein die Grenzen des Rechts theoretisch interessant seien, dann mag man dabei noch mitgehen. Wenn er aber konstatierte, es sei das Recht (als System) selbst, dass diese Grenzen festlege (S. 14f.), dann ist klar, dass man sich mitten im systemtheoretischen Kosmos befindet: »Recht hat seine Realität nicht in irgendeiner stabilen Idealität, sondern ausschließlich in den Operationen, die den rechtsspezifischen Sinn produzieren und reproduzieren.« (S. 41) Mit dieser System-Umwelt-Differenzierung lässt sich erklären, wie das Recht die Gesellschaft als sein Außen behandeln kann. Damit ergeben sich aber auch Schwierigkeiten. Fraglich ist nicht nur, wie sich Einflüsse der Umwelt auf das Rechtssystem erklären lassen, sondern auch, wie man mit Phänomenen umzugehen hat, die sich genau auf dieser Grenze bewegen.
Wie steht es mit dem Anfang des Rechts als einer ersten Grenzüberschreitung? Luhmann verabschiedete Mythen, laut denen »das Recht« erstmals gesetzt worden sein soll, um stattdessen gut autopoietisch darauf zu verweisen, dass in jeder Rechtssituation davon ausgegangen werden kann, dass auch schon früher Rechtsnormen gegolten haben (S. 57). »Das Recht« in seiner Gänze und als System wird also nie installiert – bestimmte rechtliche Rahmungen, so muss man Luhmann entgegenhalten, aber sehr wohl, nicht zuletzt auch solche grundsätzlicher Art. Revolutionen, Staatsstreiche, Ausnahmezustände und vieles andere mehr sind Situationen, in denen Recht als Gewaltakt installiert wird und sich gerade nicht autopoietisch »durch rekursive Bezugnahme rechtlicher Operationen auf rechtliche Operationen« ergibt (S. 57). Es lohnt sich daher, als Gegenmittel zu einer übergroßen Dosis Systemtheorie auf Walter Benjamin, Jacques Derrida oder Giorgio Agamben zurückzugreifen, um den – auch und gerade historisch interessanten – Situationen nachzugehen, in denen sich die vermeintlich klare binäre Differenzierung von Rechtssystem und gesellschaftlicher Umwelt auflöst.6
Vielleicht sind es besonders die juristisch grundierten Arbeiten wie »Das Recht der Gesellschaft«, die (dann eben doch: biographischen) Aufschluss über die spezifische Ausformung der Luhmann’schen Theorie zu geben vermögen. Denn das Rechtssystem kann es sich nicht leisten, Angelegenheiten in der Schwebe zu halten, Irritationen zu dulden, Probleme immer wieder hin und her zu wälzen. Es muss entscheiden, und zwar eindeutig. Luhmann behandelte daher mehrfach das Entscheidungsverweigerungsverbot des Rechtssystems: Das Recht kann nicht nicht entscheiden. Selbst in Fällen, in denen es aufgrund von Nichtwissen eigentlich gar nicht entscheiden kann, muss eine Entscheidung her. Ähnlich hat Luhmann die Systemtheorie gebaut, für die es keinen Lebensbereich gibt, der nicht ihren begrifflichen Prinzipien unterworfen werden kann. Sein verwaltungstechnisch geschultes Denken scheint mit Eindeutigkeiten operieren zu müssen.
Zusätzlich erhob er den Anspruch, mit seinem Ansatz »den gesamten Bereich der Wirklichkeit abzudecken«.7 Diese letztlich allumfassende Sichtweise stößt nicht nur auf, weil sie völlig hypertroph, sondern weil sie unhaltbar ist. Es kann keine Theorie geben, die die Wirklichkeit zur Gänze abdeckt, weil das immer schon eine Position erfordern würde, die außerhalb der Wirklichkeit zu stehen hätte. Die Wirklichkeit, die zum Thema gemacht werden soll, ist ja Bedingung der Möglichkeit der Befragung, ist also der blinde Fleck, mit dem die Systemtheorie selbst bereits operiert (um zwei andere, von Luhmann gern benutzte Begriffswerkzeuge zu zitieren).
Bei allen Problemen, die man mit Luhmanns Ansatz haben darf, ergibt sich doch eine Möglichkeit, um Unschärfen und Ausnahmen in ihrer historischen Relevanz zum Thema zu machen: Es sind die Zeitbindungen, die rechtlich (aber auch darüber hinaus) eingegangen werden müssen, wenn man innerhalb des Systems Recht operieren will. Diese Zeitbindungen sind Luhmann zufolge keineswegs einfach oder selbstverständlich, sondern erweisen sich in ihren Formen und Auswirkungen als außergewöhnlich komplex. Luhmann sprach vom Recht als einer »historischen Maschine« (S. 58, S. 107), die sich durch jede Operation in einen anderen Zustand versetze und damit neue Ausgangsbedingungen für andere Operationen schaffe. Die Historizität der Maschine sorge auch für deren Komplexität, weil sie sich durch ihre Anpassung an die jeweiligen Umstände im Prozess des Operierens gewissermaßen selbst umbaue.
Was sind nun Operationen im systemtheoretischen Sinn? Sachlich handelt es sich um die Erzeugung einer Differenz: Etwas ist nach einer Operation anders, als es zuvor war. Zeitlich sind es »Aktualisierungen sinnhafter Möglichkeiten, die im Augenblick ihrer Realisation schon wieder verschwinden« (S. 50). Mittels solcher Operationen ist das Recht als historische Maschine in der Lage, unterschiedliche Zeitbindungen nicht nur einzugehen, sondern auch selbst zu etablieren. Und im Bereich dieser Zeitbindungen wird es nicht nur systemtheoretisch prekär, sondern auch historisch und geschichtstheoretisch interessant. Denn durch solche Zeitbindungen kann das Ungefähre und Unbestimmte eindringen in die vermeintlich eindeutige Trennung von System und Umwelt.
Luhmann selbst bereitete alles für diesen Schritt vor – mit seinen an unterschiedlichen Stellen ausgeführten Überlegungen zur Zeittheorie,8 die auch im rechtlichen Rahmen relevant werden. Denn er konstatierte, dass sich – gut autopoietisch gesprochen – Recht nicht durch den Bezug auf eine oberste Norm begründen lasse, nicht durch den Verweis auf Götter, die Natur oder die Vernunft. Die Geltungsbegründung von Recht liege einzig in der Zeit. Diese temporale Geltungstheorie (S. 109f.) impliziert Unterschiedliches. Sie widersetzt sich nicht nur dem Ursprungsdenken und geht davon aus, dass sich Recht immer schon auf vorhergehendes Recht beziehen muss, sondern nimmt auch eine Gleichzeitigkeit aller Operationen eines Systems an. Was im Recht geschieht, geschieht jetzt und nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft. Gewesenes und Künftiges dienen nur als leere Horizonte der Orientierung.
Das Recht verlässt sich also nicht auf eine immer schon feststehende und eindeutige Vergangenheit und bestimmt auch nicht eine erwartbare Zukunft. Angemessener ist vielmehr die Beschreibung, »daß die Zuteilung der Werte Recht und Unrecht von dem abhängt, was im Zeitpunkt der Entscheidung als Vergangenheit behandelt werden kann« (S. 197). Mit der Zukunft wird kaum anders umgegangen: »Das Rechtssystem verfügt über Möglichkeiten, Entscheidungen aufzuschieben und eine Zeitlang im Ungewissen zu operieren. Es nutzt, da Zukunft immer als ungewiß vor Augen steht, diesen Zeithorizont aus, um selbst Ungewißheit zu erzeugen und zu erhalten mit der Aussicht, später zu einer (jetzt noch nicht entscheidbaren) Entscheidung zu kommen.« (S. 207)
Für das gerichtliche Entscheiden hat dieser zeittheoretische Ansatz Auswirkungen, die – so Luhmann – »besonders für Juristen unakzeptabel sein mögen« (S. 309), die für Historiker*innen aber umso interessanter sein könnten. Denn in der Konsequenz bedeutet das: »[…] die Entscheidung ist durch die Vergangenheit (inclusive natürlich: erlassenen Gesetze, begangene Taten) nicht determiniert. Sie operiert innerhalb ihrer eigenen, für sie nur gegenwärtig möglichen Konstruktion. Andererseits hat sie Folgen für die Gegenwarten in der Zukunft. Sie öffnet oder verschließt Möglichkeiten, die ohne sie nicht bestehen würden.« (S. 309, Hervorhebungen im Original)
Luhmann wollte diese – wie ich finde: sehr überzeugende – zeittheoretische Grundlage nutzen, um das Argument der Autopoiesis eines Systems beziehungsweise der System-Umwelt-Differenz zu stärken. Tatsächlich habe ich aber den Eindruck, dass sie eher hilft, die Eindeutigkeit dieser Differenz zu unterminieren, gerade weil durch die unterschiedlichen Zeitbindungen die Unwägbarkeiten, Unschärfen und Unbestimmtheiten ins Spiel kommen, welche die Systemtheorie zu scheuen scheint wie der Teufel das Weihwasser. Gerade weil nicht klar ist, welche Vergangenheiten im Hier und Jetzt rechtlich relevant werden können oder welche Zukünfte durch gegenwärtige Entscheidungen (v)er(un)möglicht werden, tun sich – nicht nur im Sinne konkreter Handlungen, sondern auch im Zusammenhang des theoretischen Designs – Lücken auf, welche die systemische Abgeschlossenheit unterlaufen.
Nochmals auf die gerichtliche Entscheidung gemünzt: Gerichte wissen, so Luhmann, dass sie sich auf eine Zukunft beziehen, die sie nur sehr bedingt determinieren können, weil immer noch so viele andere Entscheidungen mit hineinspielen, die diese Zukunft ebenfalls beeinflussen werden. Im Gegenzug versuchen sie sich auf eine vermeintlich fixierte Vergangenheit zu verlassen, die sie in ihrer jeweils spezifischen Ausformung aber erst im Zuge des gerichtlichen Verfahrens und der schließlichen Entscheidung zurichten müssen (S. 325-327).
Man kann also, nicht nur dank solcher argumentativer Instrumentarien, bei Luhmann kaum den Eindruck haben, dass seine Systemtheorie heute, gut 20 Jahre nach seinem Tod, veraltet wirkt. Dafür ist sie zu sehr »Theorie«. Der Status eines Klassikers, den er sich bereits zu Lebzeiten mit Gedankenfülle und Fleiß erarbeitet hatte, wurde in den vergangenen Jahren zementiert durch die dafür üblichen Maßnahmen: Fachtagungen, Gedenkveranstaltungen, Nachlassveröffentlichungen.9 Aber fruchten kann all das nur, wenn der Boden dafür bereitet ist – wenn Luhmann also immer noch zu uns spricht. Und das tut er ganz offenbar.
Anmerkungen:
1 Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Neuwied 1969; ders., Rechtssoziologie, 2 Bde., Reinbek bei Hamburg 1972; ders., Kontingenz und Recht. Rechtstheorie im interdisziplinären Zusammenhang, hg. von Johannes F.K. Schmidt, Berlin 2013.
2 Vgl. dazu die Tagung »Niklas Luhmann am OVG Lüneburg«, abgehalten an der Leuphana Universität Lüneburg am 5./6. Dezember 2017. Das Programm der Tagung und Videos der Vorträge sind einzusehen unter <https://www.leuphana.de/dfg-programme/mecs/veranstaltungen/vergangene-veranstaltungen/niklas-luhmann-am-ovg.html>.
3 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1997, S. 11.
4 Ders., Einführung in die Systemtheorie, hg. von Dirk Baecker, Heidelberg 2002, 7. Aufl. 2017; ders., Einführung in die Theorie der Gesellschaft, hg. von Dirk Baecker, Heidelberg 2005, 2. Aufl. 2009.
5 Zur Kooperation von Systemtheorie und Geschichtswissenschaft vgl. exemplarisch Frank Becker/Elke Reinhardt-Becker, Systemtheorie. Eine Einführung für die Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frankfurt a.M. 2001; Frank Becker (Hg.), Geschichte und Systemtheorie. Exemplarische Fallstudien, Frankfurt a.M. 2004; Rudolf Schlögl, Anwesende und Abwesende. Grundriss für eine Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, Konstanz 2014.
6 Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt [1921], in: ders., Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze. Mit einem Nachwort von Herbert Marcuse, Frankfurt a.M. 1965, S. 29-65; Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der »mystische Grund der Autorität«, Frankfurt a.M. 1991; Giorgio Agamben, Ausnahmezustand, Frankfurt a.M. 2004.
7 Niklas Luhmann, Archimedes und wir. Interviews, Berlin 1987, S. 163.
8 Ders., Temporalisierung von Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1980, S. 235-300; ders., Die Zukunft kann nicht beginnen. Temporalstrukturen der modernen Gesellschaft, in: Peter Sloterdijk (Hg.), Vor der Jahrtausendwende. Berichte zur Lage der Zukunft, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1990, S. 119-150; ders., Gleichzeitigkeit und Synchronisation, in: ders., Soziologische Aufklärung, Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990, 2. Aufl. 1993, S. 95-130.
9 Siehe v.a. das Bielefelder und Kölner Langzeitforschungsprojekt »Niklas Luhmann – Theorie als Passion. Wissenschaftliche Erschließung und Edition des Nachlasses« (2015–2030): <https://niklas-luhmann-archiv.de>.
Zum Weiterlesen:
Das Register der Rubrik »Neu gelesen« finden Sie hier.