Niall Ferguson, vormals Fellow and Tutor in Modern History in Oxford und jetzt Professor of International History an der Harvard University, steht ohne Zweifel in der Tradition debattierfreudiger und argumentationsstarker britischer Historiker. Neben fundierten Einzelstudien, vor allem zur Geschichte Hamburgs in der Weimarer Republik und zur Geschichte der Familie Rothschild, zielen seine häufig provozierenden Arbeiten auf eine breite historisch interessierte Öffentlichkeit.1 Mit seiner medialen Präsenz steht er in der Tradition britischer „Tele-Dons“ nach dem Vorbild des Oxford-Historikers A.J.P. Taylor. Der Blick in die Vergangenheit dient auch für Ferguson nicht allein der Aufklärung der Gegenwart, sondern als konkrete Handlungsanweisung in politischen Krisen und damit der Legitimation des Historikers als eines politischen Ratgebers. Dazu kommt die ausgeprägte Lust des Autors an der Dekonstruktion vermeintlich etablierter historischer Wahrheiten. Aber bereits im Falle seines provozierenden Buches über Großbritanniens Rolle im Ersten Weltkrieg2 monierten nicht wenige Rezensenten, dass Ferguson sich verzweifelt bemühe, Türen einzurennen, die seit langem offen stehen.
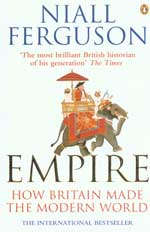
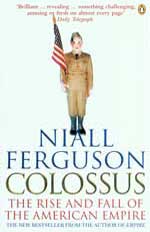
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung zweier in kurzem Abstand erschienener Bücher über das britische und das amerikanische Empire kann vor diesem Hintergrund nicht überraschen.3 Denn mit der Globalisierung der Wirtschaftsmärkte und Finanzströme auf der einen Seite sowie der terroristischen Dimension nach dem 11. September 2001 stellt sich die Frage nach den globalen Bedingungen für politische Stabilität und ökonomischen Fortschritt neu und radikaler als zuvor. Daher sind beide Bücher nicht von der nach dem September 2001 konzipierten amerikanischen und britischen Sicherheitsdoktrin und dem damit verbundenen Bekenntnis zur internationalen Intervention zu trennen. Gerade darin erkennt Ferguson Ansätze eines neuen imperialen Politikstils zur Stabilisierung und Demokratisierung von Krisenregionen, für die Afghanistan und Irak die bekanntesten und zugleich problematischsten Beispiele darstellen.
Von den kritischen Prämissen der angloamerikanischen Empire-Historiographie in der Folge der von Edward Said begründeten Postkolonialismus-Debatte unterscheiden sich beide Bücher grundlegend. Said gelang es, die den zeitgenössischen Empire-Diskurs prägenden Orientwissenschaften als Teil eines seit der Aufklärung vorherrschenden Europazentrismus und damit als Legitimationsinstrument für die Expansion und Verdichtung politischer Herrschaft und kultureller Dominanz darzustellen.4 Die Rezeption von Saids Thesen hat innerhalb der Empire-Forschung den Trend von der diplomatie-, politik- und wirtschaftshistorischen Zielsetzung zu sozial- und vor allem kulturgeschichtlichen Vorgehensweisen enorm verstärkt.5 Ferguson geht es dagegen gerade nicht um kulturalistische Fragen nach den komplexen Beziehungen zwischen Metropolen und Kolonien oder um eine kritische Sicht der kulturellen Imperialismen. Seine Position ist vielmehr geprägt von den Fragen nach den Bedingungen internationaler Stabilität, die durch die Entwicklungen und Konflikte seit dem Ende des Kalten Krieges 1989/91 und der globalen Dimension des Terrors seit 2001 eine veränderte Bedeutung erlangt haben. Dabei verknüpft er in beiden Büchern die Geschichte des britischen Empire und seiner welthistorischen Funktionen mit der aktuellen Situation der Vereinigten Staaten. Für ihn verheißt der Blick in die Vergangenheit des britischen Empire nicht allein Aufschluss über die erste umfassende und erfolgreiche Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts, sondern liefert auch eine entscheidende außenpolitische Handlungsanweisung für die Gegenwart. Im Ergebnis wird der Begriff des Empire von seinen kritischen oder negativen Konnotationen gelöst und als alternatives Handlungsmuster für die Lösung von politischer, sozialer und ökonomischer Ungleichheit zwischen Erster, Zweiter und Dritter Welt, von Demokratiedefiziten und internationaler Instabilität entwickelt. Gareth McLean hat die Thesen Fergusons denn auch pointiert mit dem Satz zusammenfassen können: „Empires aren’t actually that bad.“6
2![]()
Wie in seinen anderen Büchern entwickelt Ferguson eine provokante These, die sich suggestiv vermitteln lässt und auf welche die empirischen Befunde des Buches hinauslaufen. Der mediale Vorteil der Stringenz und Unterhaltsamkeit ist zugleich der analytische Nachteil des Buches, denn die Auswahl der Argumente ist selektiv und nicht selten auch anekdotisch. Bereits der Untertitel „How Britain Made the Modern World“ gibt die These wider. Für Ferguson besteht kein Zweifel daran, dass die Globalisierung kein Schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts ist, sondern eine Leistung des britischen Empire, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts am besten dokumentieren lässt - vor allem im Blick auf Indien und Ägypten. Für diese Annahme einer Globalisierung vor der Globalisierung rekurriert Ferguson nicht auf eine imperialismuskritische Sicht, sondern auf die besonderen Leistungen des britischen Empire: den Export der englischen Sprache und deren Entwicklung zum globalen Sprachmedium der Welt, das anglikanische Christentum, demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, kapitalistische Produktionsweise und freien Welthandel. Das Empire trug in dieser Sicht nicht zur Vertiefung, sondern zur Verringerung der Kluft zwischen den industrialisierten Staaten Europas und Nordamerikas einerseits sowie Afrikas und Asiens andererseits bei. Um 1900, so Fergusons These, stand das Empire als Motor und Katalysator für eine erste erfolgreiche Globalisierung von wirtschaftlicher und handelspolitischer Dynamik, für eine neue Stufe in der Mobilität von Menschen, Kapital und Wissen sowie der transnationalen Kommunikation.
Auch wenn Ferguson in seiner Darstellung immer wieder auf Rassismus, Segregation zwischen Kolonialeliten und indigener Bevölkerung und die zahllosen small wars des britischen Empire zu sprechen kommt, überwiegt für ihn die Zivilisationsleistung und der Modernitätserfolg, der eben nicht allein für das Mutterland selbst, sondern vor allem für die Kolonialgesellschaften gegolten habe. Gerade der Export britischer Institutionen sei für diese Gesellschaften zum Kern ihrer späteren Entwicklung geworden. Als Beleg für dieses Argument zieht Ferguson das Verhältnis zwischen Großbritannien und den nordamerikanischen Kolonien heran. Der Kampf um die staatsrechtliche Sezession und die Gründung der Vereinigten Staaten sei aus einem Konflikt innerhalb der Siedlergesellschaft entstanden. Einerseits habe diese Entwicklung die Lösung der Sklavenfrage nur vertagt und die USA damit langfristig belastet. Andererseits sei das genuin britische Erbe des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Puritanismus im Zusammenhang mit der Möglichkeit kapitalistischer Profitmaximierung und Handelsfreiheit zur Wurzel des amerikanischen Aufstiegs zur Weltmacht im Verlauf des 19. und frühen 20. Jahrhunderts geworden. Aber muss man zu solchen Aussagen wirklich das Empire bemühen, oder kann nicht auch Max Webers Grundtext über den Zusammenhang von protestantischer Ethik und kapitalistischem Geist7 noch immer analytischere Aufschlüsse liefern?
Als Wasserscheide der Wahrnehmung des britischen Empire bewertet Ferguson, auch darin durchaus nicht neu, die Phase des Burenkriegs und des Ersten Weltkriegs. Damals seien die militärischen und politischen Kosten des Empire in den Vordergrund getreten, während gleichzeitig die Idee einer anglikanischen Missionsidee an Wirkungskraft eingebüßt habe. Unter diesen Umständen habe sich auch der Liberal Imperialism eines Joseph Chamberlain, der eine Verbindung zwischen imperialer Expansion und innenpolitischen Reformen anstrebte, nicht mehr durchsetzen können. Chamberlains Einsatz für eine südafrikanische Föderation unter britischer Kontrolle führte 1899 zum Burenkrieg, der die militärische Verwundbarkeit und diplomatische Isolation Großbritanniens dokumentierte. Chamberlains Konsequenz war der Plan einer durch Schutzzölle intensivierten Beziehung zwischen Mutterland und Kolonien, deren ökonomische Erträge einer sozialliberalen Reformoffensive im Mutterland zugutekommen sollten. Trotz der mit dem „Daily Telegraph“ verbundenen Medienkampagne „Think Imperially“ scheiterten diese Pläne 1906 am Unwillen der britischen Wähler. Mit dem Ersten Weltkrieg vergrößerte sich zwar noch einmal der Umfang des Weltreichs, aber die Konzentration auf die innenpolitischen Probleme der Nachkriegszeit und die wirtschaftliche Krise seit dem Ende der 1920er-Jahre ließen die Kritik an der Überdehnung des Empire immer stärker werden.
3![]()
Obwohl Ferguson diesen Umbruch der Wahrnehmung und den Wandel vom viktorianischen Selbstbild der Empire-Nation zur wachsenden Empire-Kritik nach 1900 und nach 1918 zeigt, betont er die existenzielle Funktion des Weltreichs für das Überleben Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg. Das bekannte Argument spitzt Ferguson aber noch weiter zu, denn auch die Tatsache, dass die Kolonien vor den Übergriffen der totalitären Mächte Deutschland, Italien, Japan und Sowjetunion letztlich bewahrt worden seien, unterstreiche das positive Erbe des britischen Empire. An den britischen Dekolonisierungserfahrungen und ihren langfristigen Folgen zeigt Ferguson dagegen kaum mehr als ein kursorisches Interesse. Eine genauere Analyse der blutigen Dekolonisierungsfolgen in Indien durch die Abspaltung Pakistans oder der weiteren Entwicklung in Kenia, Zimbabwe oder Bangladesh hätte die Empire-Apologie in einem ambivalenteren Licht erscheinen lassen. Auch die innen- und gesellschaftspolitischen Folgen der Masseneinwanderung aus den ehemaligen Kolonien nach Großbritannien8 und das Scheitern der Integrationsstrategien durch urbane Segregationsprozesse in der Gegenwart bleiben ausgeklammert. Der These des „How Britain made the Modern World“ hätten sie einen gänzlich anderen Sinn gegeben, und zur Handlungsanleitung hätte eine solche Problemgeschichte der gescheiterten Integration auch nicht getaugt.
Fergusons Buch „Empire“ geht aber nicht in einer nostalgieverschleierten Empire-Rhetorik auf, wie sie die Hochkonjunktur diesbezüglicher Publikationen auch zu bieten hat.9 Die analytischen Stärken werden dort sichtbar, wo der Autor thematisch am besten informiert ist, also auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Finanzgeschichte. Der Export von Menschen, Kapital und Wissen katalysierte den Wandel weit über Europa hinaus. Aber nicht unproblematisch ist die Ausweitung dieser These zu einer neuen Funktionalisierung des Empire, das nicht nur als wirtschaftliche, sondern auch als politische und rechtliche Modernisierungsagentur herangezogen, ja als Modell einer Weltregierung stilisiert wird: „In short, what the British Empire proved is that empire is a form of international government that can work - and not just for the benefit of the ruling power. It sought to globalize not just an economic but a legal and ultimately a political system too.“10 Solche Zuspitzungen wirken, als kehrten Vorstellungen der Whig Interpretation of History auf der Ebene des britischen Weltreichs wieder zurück. Diese liberale Meistererzählung des 19. Jahrhunderts betonte die seit den Konflikten zwischen Monarchie und Parlament im 17. Jahrhundert erkämpften Freiheitsrechte gegenüber den absolutistischen Monarchien Kontinentaleuropas und leitete davon die universelle Pionierleistung Großbritanniens, die Harmonisierung von politisch-konstitutionellen und sozialökonomischen Fortschritten seit der Glorious Revolution 1688/89 ab. Im Ergebnis ließ sich die englische Geschichte als evolutionär-konfliktfreies Modell gegenüber den blutigen Revolutionen des Kontinents stilisieren. Aber schon ein kurzer Blick auf die Ambivalenzen des Empire, die zumal in der auch für Großbritannien keinesfalls unblutigen Phase der Dekolonisierung zutage traten, zeigt, dass solche retrospektiven Idealisierungen zu kurz greifen, um dem Empire-Erbe gerechtzuwerden.
Fergusons Empire-Apologie aus dem Geist einer Geo-Realpolitik hat ein klares Ziel, das auf den letzten Seiten seines Buches „Empire“ deutlich wird und das er unter dem Schlüsselbegriff der „Anglobalization“ behandelt.11 Dabei geht es um die Lehren aus der Geschichte des britischen Empire für die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Sinne einer globalen translatio imperii müssten die USA das Erbe des britischen Empire, seine internationale Fortschritts- und Stabilisierungsfunktion, annehmen und entsprechend handeln. Hier dient die Geschichte des britischen Empire als Kriterium und Handlungsmuster für die Gegenwart. Das Ergebnis ist eine Aufforderung an die USA, den von Rudyard Kipling einst artikulierten White Man’s Burden ernstzunehmen und sich nicht auf einen selbstgewählten Isolationalismus zurückzuziehen. Faktisch seien die USA „an empire that lacks the drive to export its capital, its people and its culture to those backward regions which need them most urgently and which, if they are neglected, will breed the greatest threats to its security. It is an Empire, in short, that dare not speak its name. It is an empire in denial.“12 Auch in Großbritannien hat diese These eine kontroverse Diskussion angeregt: Während etwa Linda Colley versucht hat, die Verantwortung Großbritanniens für die späteren Leiden der ehemaligen Kolonien zu relativieren, hat vor allem Paul Gilroy gegen die Idee eines neuen nordamerikanischen Imperiums in der Tradition des britischen Empire argumentiert und als Gegenentwurf den Begriff der conviviality eingeführt, eine tolerante Gastfreiheit und das mögliche Nebeneinander von Ethnien in den postkolonialen Metropolen.13
4![]()
Im Kontext einer außen- und sicherheitspolitischen Handlungsanleitung steht auch Fergusons Buch über Aufstieg und Fall der Vereinigten Staaten als eines sich selbst verleugnenden Empire. Wiederum nimmt Ferguson die historischen Leistungen des britischen Empire als Maßstab für ein Liberal Empire, zu dem sich die Vereinigten Staaten bekennen müssten, denn weder in der Europäischen Union noch in den Vereinten Nationen und auch nicht in dem von beiden Akteuren vertretenen Multilateralismus kann er machtvolle Faktoren einer möglichen internationalen Stabilisierung erkennen.14 Nur so könnten die USA als verbliebene ökonomische, politische und militärische Supermacht ihrer international stabilisierenden und demokratisierenden Aufgabe in einer unübersichtlich gewordenen Welt gerecht werden. Die gedeutete Geschichte als Handlungsanweisung für die Gegenwart tritt in diesem Buch noch stärker hervor als in der über weite Strecken analytischeren Darstellung des britischen Empire. Fergusons Buch über das amerikanische Empire gerät demgegenüber immer wieder zu einer Expertise im Stil nordamerikanischer Think Tanks, bei der geopolitisches Wunschdenken mit der Kritik an amerikanischen Politikeliten und konkreten Handlungsanleitungen konvergiert. Das Leitmotiv dieser historisch informierten Kritik ist die These, dass die USA nach dem Ende siegreicher Feldzüge versagt hätten. Immer wieder seien die dann eingesetzten Mittel für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Entwicklung demokratischer Institutionen zu gering gewesen. Dem militärischen Triumph sei so immer wieder eine Phase der Enttäuschung und des Rückzugs gefolgt. Demgegenüber appelliert Ferguson an imperiale Entschlossenheit, wie er sie etwa in der Person von General MacArthur erkennt. Die Argumentation für eine derart entschlossene Strategie im Vietnamkrieg oder in den Konflikten mit China und Nordkorea hat wenig mit historischer Analyse, aber viel mit einem einseitig machtorientierten Wunschdenken zu tun, das auch vor offener politischer Parteinahme nicht zurückschreckt.
Ferguson selbst ist in gewisser Weise ein Produkt der „Anglobalization“, wie sein mediales Pendeln zwischen den USA und Großbritannien sowie seine Präsenz in Oxford, New York und Harvard demonstrieren. Das mag auch sein Bemühen erklären, der Bereitschaft zur weltweiten Intervention in der britischen und amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik mit dem Vorbild des britischen Empire und der Aktualisierung eines Liberal Imperialism eine eigene Kontur zu geben. Gegenüber dieser atlantischen special relationship bleibt der alternative Blick auf Kontinentaleuropa bei de Gaulles Prämisse von der bloßen Addition der Vaterländer stehen.15 Diese Perspektive macht die provokante Stärke und die argumentative Schwäche von Fergusons Büchern aus: Methodisch und stilistisch bekennt er sich zur Tradition einer realpolitischen und machtorientierten Empire-Historiographie, die alle Aspekte der kulturalistischen Debatten um Postcolonialism souverän ignoriert. Wo seine Analyse die wirtschafts- und finanzhistorischen Aspekte des britischen Empire behandelt, die Interaktion zwischen Metropole und Peripherien, da gelingt es ihm, die Ambivalenz der imperialen Erfahrung etwa für Ägypten und Indien durchaus überzeugend zu demonstrieren. Wo er aber nach Handlungsanweisungen für die amerikanische Außen- und Militärpolitik sucht und die Geschichte auf ein Legitimationsreservoir reduziert, da erscheint seine Empire-Apologie als eine einseitige Suche nach Pionieren, denen es im neuen Zeitalter der Unübersichtlichkeit nachzueifern gelte.
1 Niall Ferguson, Paper and Iron. Hamburg Business and German Politics in the Era of Inflation, 1897-1927, Cambridge 1995; ders., Die Geschichte der Rothschilds. Propheten des Geldes, 2 Bde., Stuttgart 2002.
2 Niall Ferguson, The Pity of War, New York 1999, dt.: Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, Stuttgart 1999.
3 Niall Ferguson, Empire. How Britain Made the Modern World, London 2003 (in den USA erschienen als: Empire. The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power, New York 2003); ders., Colossus. The Rise and Fall of the American Empire, London 2004 (in den USA erschienen als: Colossus. The Price of America’s Empire, New York 2004); dt.: Das verleugnete Imperium. Chancen und Risiken amerikanischer Macht, Berlin 2004.
4 Vgl. Edward W. Said, Orientalism, London 1978; ders., Culture and Imperialism, London 1993; John M. MacKenzie, Orientalism. History, Theory, and the Arts, Manchester 1995; Jürgen Osterhammel, Edward W. Said und die „Orientalismus“-Debatte. Ein Rückblick, in: Asien - Afrika - Lateinamerika 25 (1997), S. 597-607; Alexander L. Macfie (Hg.), Orientalism. A Reader, Edinburgh 2000; vgl. auch Carol A. Breckenridge/Peter van der Veer (Hg.), Orientalism and the Postcolonial Predicament. Perspectives on South Asia, Philadelphia 1993; Tony Ballantine, Orientalism and Race. Aryanism in the British Empire, Basingstoke 2002.
5 Vgl. Ronald B. Inden, Imagining India, Oxford 1990; Mrinalini Shinha, Colonial Masculinity. The ‚Manly‘ Englishman and the ‚Effeminate‘ Bengali in the Late Nineteenth Century, Manchester 1995; Anne McClintock, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Context, New York 1995; Catherine Hall (Hg.), Cultures of Empire. Colonizers in Britain and the Empire in the 19th and 20th Centuries, New York 2000; Peder Anker, Imperial Ecology. Environmental Order in the British Empire 1895-1945, Cambridge 2001; Mary Procida, Married to the Empire. Gender, Politics and Imperialism in India 1883-1947, Manchester 2002; Purnima Bose, Organizing Empire. Individualism, Collective Agency, and India, Durham 2003; Elizabeth Buettner, Empire Families. Britons and Late Imperial India, Oxford 2004.
6 Gareth McLean, Imperial Weight, in: Guardian, 10.1.2003.
7 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus [1905]. Vollständige Ausgabe, hg. von Dirk Kaesler, München 2004.
8 Vgl. Imke Sturm-Martin, „Race, colour or religion“. Der politische Blick auf Minderheitenreligionen in Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3 (2005), S. 409-428.
9 Vgl. Denis Judd, The Lion and the Tiger. The Rise and Fall of the British Raj, 1600-1947, Oxford 2004.
10 Ferguson, Empire (Anm. 3), S. 371.
11 Ebd., S. 379.
12 Ebd., S. 381. Siehe zu dieser Diskussion auch den Beitrag von Michael Hochgeschwender in diesem Heft.
13 Linda Colley, Captives. The Story of Britain’s Pursuit of Empire and How Its Soldiers and Civilians were held captive by the Dream of Global Supremacy, 1600-1850, New York 2002; Paul Gilroy, After Empire. Melancholia or Convivial Culture, Oxford 2004.
14 Ferguson, Colossus (Anm. 3), S. 169ff., S. 227ff.; vgl. auch Bernd Greiner, Die Welt als Wille und Vorstellung. Niall Ferguson über die Notwendigkeit eines ‚liberalen Imperiums‘, in: ZEIT, 1.7.2004, S. 44.
15 Ferguson, Colossus (Anm. 3), S. 256f.
![]()
