Chinesische Seeleute und Chinesenviertel in westeuropäischen Metropolen vor 1945
2. Imaginationen:
Gesellschaftliche und behördliche Reaktionen
3. Kulinarische Globalisierung:
Chinesische Migration und Gastronomie nach 1945
4. Fazit
Metropolen und Migration stehen in einem engen Wechselverhältnis.1 Großstädte werden immer wieder als „Magneten“ charakterisiert, die Fremde geradezu unwiderstehlich anziehen würden.2 Diese technizistische Metapher ist eingängig, aber kaum treffend, da Migranten trotz möglicher wirtschaftlicher Not in ihrer Herkunftsregion immer auch Akteure sind, die ihren Ortswechsel häufig aufgrund persönlicher oder familiärer Kontakte planen. Wenn wir die Metropole als „Weltstadt“, als national und international bedeutendes politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum definieren, dann wirken weltweite Verflechtungen auch auf den urbanen Raum zurück und manifestieren sich in ihm. In Metropolen verbinden sich lokale, nationale und globale Entwicklungen; gerade deshalb lassen sich transnationale Prozesse dort deutlich erkennen.
Dies gilt für die Gegenwart, aber ebenso in historischer Perspektive. Neben Binnenwanderung, meist aus benachbarten Regionen, war gerade auch internationale Migration in Metropolen ubiquitär. Westliche Metropolen wie London und Paris erlangten und repräsentierten ihre „Internationalität“ auch mittels temporär anwesender oder eingewanderter Ausländer. In der Hochphase des europäischen Imperialismus um 1900 waren Metropolen voller kolonialer Verweise in Architektur und Alltag, wozu auch ethnische Gruppen aus den kolonialisierten Ländern beitrugen.
Am Beispiel chinesischer Seeleute und Migranten soll hier in sozial- und kulturgeschichtlicher Perspektive gefragt werden, wie sich „Fremde“ aus einem anderen Teil der Welt in europäischen Großstädten einrichteten und wie sie von den städtischen Gesellschaften wahrgenommen wurden. Als Untersuchungsorte dienen vor allem London, Rotterdam und Hamburg; punktuell gehe ich in diesem Beitrag auch auf Berlin, Amsterdam, Paris und Liverpool ein.3 Hafenstädte stehen im Mittelpunkt, weil chinesische Migranten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem auf maritimen Wegen nach Westeuropa gelangten. In den großen westeuropäischen Hafenstädten bildeten sich „Chinesenviertel“, die für das Erscheinungsbild dieser Städte wichtig wurden.
2![]()
Chinesische Migration kann wegen ihrer symbolischen Aufladung in der westlichen Welt nicht ohne den Kontext gesellschaftlicher Wahrnehmungen und Imaginationen untersucht werden. Westliche Gesellschaften produzierten in Bezug auf China und Chinesen diffuse Bedrohungsszenarien, die um die große Bevölkerungszahl, eine mögliche Industrialisierung des Landes sowie die verstärkte Auswanderung seit dem 19. Jahrhundert kreisten. Das populäre Schlagwort von der „gelben Gefahr“ suggerierte eine kulturelle und „rassische“ Bedrohung des christlichen Abendlandes.4 In der Figur des „Kuli“ wurden Chinesen eine Projektionsfläche für Ängste europäischer Arbeiter und Wünsche von Arbeitgebern.5 Chinesische Arbeitsmigration entwickelte sich zu einem Aspekt von Globalisierung, der die Vorstellungen nationaler Arbeit zu unterminieren schien. Wegen ihrer hohen Mobilität ist es eigentlich unangemessen, die Geschichte chinesischer Migranten in Europa nach Nationalstaaten getrennt zu untersuchen, da sie sich vielmehr in einem sozialen Netzwerk und einem transnationalen Raum zwischen Südchina und den nordwesteuropäischen Hafenstädten bewegten.6 Auch zwischen den Chinesenvierteln westeuropäischer Städte etablierten sich enge Kontakte, die mittels regelmäßiger Schifffahrtslinien verstetigt werden konnten.
Die Quellenlage für diesen Artikel ist wegen des Mangels chinesischer Dokumente (und fehlender Sprachkenntnisse des Autors) sehr asymmetrisch. Als Quellen dienen im Folgenden hauptsächlich schriftliche Dokumente behördlicher Provenienz und zeitgenössische Veröffentlichungen aus Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland. Die in den verschiedenen nationalen und lokalen Archiven überlieferten Dokumente ermöglichen es aber zumindest punktuell, auch die Perspektive der chinesischen Akteure aufzuzeigen. Zugleich erlaubt es die Materialgrundlage, die gesellschaftlichen Reaktionen und Imaginationen gegenüber chinesischen Migranten zu untersuchen. In einer kombinierten Migrations- und Wahrnehmungsgeschichte möchte ich darstellen, wie chinesische Migration als urbane Bedrohung sowie andererseits als kulturelle Bereicherung empfunden wurde. Wegen des langen Untersuchungszeitraums und der verschiedenen Untersuchungsorte kann dies hier nur skizzenhaft geschehen. Im ersten Teil werden die Beschäftigungsverhältnisse von Chinesen und die Entstehung kleiner Chinesenviertel in westeuropäischen Metropolen erörtert. Im zweiten Teil werden die gesellschaftlichen und behördlichen Reaktionen auf die globale Migration untersucht, während es im dritten Teil um die Erfolgsgeschichte der chinesischen Gastronomie in westeuropäischen Großstädten geht. Die in den 1950er-Jahren beginnende Ausbreitung von China-Restaurants markierte eine neue Phase für die chinesische Migrations- und die westeuropäische Metropolengeschichte sowie für die damit verbundenen Imaginationen.
1. Migrationen: Chinesische Seeleute und Chinesenviertel in westeuropäischen Metropolen vor 1945
Europa lag lediglich am Rand chinesischer Migration. Das bevorzugte Gebiet war Südostasien, das südliche Meer (nanyang).7 Auswanderung hatte im China der Qing-Dynastie (1644-1911) lange Zeit den Makel des Vaterlandsverrates, auch wenn es sich um temporäre Migration handelte.8 Im Chinesischen entstand für die Chinesen im Ausland der Begriff des Gastes (qiao), was die enge Bindung an Familie und Herkunft betonte. Die bevölkerungsreichen südlichen Provinzen Guangdong und Fujian waren die Hauptgebiete chinesischer Auswanderung - nicht zuletzt deshalb, weil dort mit Hongkong und Shanghai die großen Häfen des Landes lagen. Sagenhafte Legenden über Kalifornien, die „goldenen Berge“, forcierten während des Goldrauschs um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Migration in die USA.
3![]()
Seit den 1890er-Jahren waren chinesische Arbeitskräfte dann auch bei europäischen Unternehmen beschäftigt. Englische Reedereien9 wie die Blue Funnel Line aus Liverpool, deutsche10 wie die Hapag aus Hamburg und der Norddeutsche Lloyd aus Bremen sowie später niederländische11 wie die Java-China-Lijn heuerten Chinesen neben Indern und Afrikanern als Heizer und Trimmer (Kohlenzieher) auf ihren Dampfschiffen an. Für die körperlich sehr anstrengende Arbeit erhielten chinesische Seeleute deutlich niedrigeren Lohn als ihre europäischen Kollegen. Die Reedereien senkten damit ihre Betriebskosten und verbrämten dies als humanistische Tat, da „Farbige“ im Vergleich zu Euro-päern biologistisch als „hitzebeständiger“ galten. Anfangs vor allem auf den Routen nach Ostasien eingesetzt, fuhren chinesische Mannschaften seit der Jahrhundertwende auch zunehmend im transatlantischen Verkehr. Zwar blieben die absoluten Zahlen mit einigen Tausend beschäftigten Seeleuten gering, aber die große Brisanz des Themas zeigte sich unter anderem darin, dass Gewerkschaften und Sozialdemokratie es regelmäßig in die Parlamente brachten und dort die betont nationalen Reeder scharf attackierten.
Die chinesischen Seeleute kamen meist aus dem Delta des Zhu Jiang (Pearl River), aus Hongkong und Kanton oder der Umgebung. Sie waren in der Regel sehr jung. Ihre Motive waren der zeitlich begrenzte Gelderwerb und die finanzielle Unterstützung ihrer kleinbäuerlichen Familien. Die Anmusterung geschah meist in Hongkong über chinesische Seemannsagenten, die ihre Position häufig ausnutzten und einen Teil der Heuer einbehielten. An Bord europäischer Handelsschiffe wurden chinesische Seeleute segregiert; ein chinesischer Oberheizer (number one) gewährleistete die Kommunikation mit der Schiffsleitung und gab die Kommandos an die 25- bis 40-köpfige chinesische Mannschaft weiter. Neben der dominierenden Tätigkeit im Feuerungsdienst konnten Chinesen aus der Tätigkeit des Wäschers eine eigene Domäne machen, da europäische Seeleute diese Arbeit aufgrund westlicher Männlichkeitsvorstellungen als zu „feminin“ ablehnten.12
Durch ihre Beschäftigung in der Handelsschifffahrt gelangten chinesische Seeleute seit dem späten 19. Jahrhundert in die großen westeuropäischen Hafenstädte. Im Londoner East End, in Limehouse unweit der East India Docks, erhielten bereits in den 1880er-Jahren einige Straßen eine chinesische Prägung, und alsbald war vom „Chinese quarter“ die Rede.13 Ehemalige chinesische Seemänner eröffneten hier Lokale, Unterkünfte und Geschäfte. Sie lebten vor allem von den kurzfristig in der Stadt verweilenden chinesischen Seeleuten.14 Chinesische Wäscher profitierten von ihrem guten Ruf und eröff-neten auch an Land eigene Wäschereien. Wegen des maritimen Charakters der chinesischen Migration in London gab es im Alltag eine beträchtliche Fluktuation. Nach Ankunft im Hafen gingen chinesische Seeleute sofort zur „Straße der Chinesen“ in Limehouse, um Landsleute zu treffen und kantonesische Speisen zu essen. Eine wichtige Freizeitbeschäftigung für chinesische Seeleute waren Spiele wie Mahjong und Fan Tan; ein Teil von ihnen rauchte auch Opium, das im 19. Jahrhundert in England in Form von Laudanum weit verbreitet war.15 Auch in anderen britischen Hafenstädten wie Liverpool und Cardiff entstanden um die Jahrhundertwende kleine chinesische Kolonien.16 Die Zahl der Einwanderer blieb recht gering - in London wurden 1911 beispielsweise lediglich 247 chinesische Staatsangehörige statistisch erfasst, deren Zahl dann in den 1920er- und 1930er-Jahren trotz regelmäßiger Ausweisungen anstieg.

Chinesisches Gemüsegeschäft im Limehouse Causeway Anfang der 1930er-Jahre
(Quelle: Tower Hamlets Local Historical Library & Archives, London)
4![]()
Auch nach Hamburg gelangten wegen der internationalen Bedeutung des Hafens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts chinesische Seeleute.17 Wie ihre europäischen Kollegen flanierten sie während des Landganges vor allem durch das Vergnügungsviertel St. Pauli, weshalb das sozialdemokratische „Hamburger Echo“ 1901 schrieb, dort seien ganze „Rudel“ von Chinesen anzutreffen.18 In den frühen 1920er-Jahren ließen sich chinesische Seeleute vermehrt in St. Pauli nieder, vor allem in der kurzen Schmuckstraße nahe der Großen Freiheit. Wie in London eröffneten chinesische Migranten dort Lokale, Geschäfte und Unterkünfte. Viele Chinesen kamen aus englischen Hafenstädten, da es sich herumsprach, dass das Preisniveau für Personen mit Valuta aufgrund der Geldentwertung sehr günstig sei. Ein weiterer wichtiger Faktor war der deutsch-chinesische Friedensvertrag von 1921, in dem sich das demokratische Deutschland und die Chinesische Republik die wirtschaftliche Betätigungsmöglichkeit ihrer Staatsangehörigen im jeweils anderen Land zusicherten.19 Das Auswärtige Amt dachte dabei an die vielen deutschen Kaufleute in Shanghai und ging nicht davon aus, dass sich auch in deutschen Städten eine chinesische Kolonie etablieren könnte. Doch schon bald sprachen die Hamburger von einem „Chinesenviertel“ in St. Pauli, was angesichts weniger hundert Chinesen allerdings etwas übertrieben war.20
Ebenso wie in Hamburg entstand auch in Rotterdam und Amsterdam in den frühen 1920er-Jahren eine chinesische Prägung einiger Straßen. Den Beginn der chinesischen Migration in die Niederlande markierte der internationale Seeleutestreik von 1911, da niederländische Reedereien wie der Rotterdamsche Lloyd chinesische Seeleute in London anheuerten und diese nach Rotterdam und Amsterdam brachten, wo sie als „Streikbrecher“ Zielscheibe wütender Proteste wurden.21 In Rotterdam bildete sich nach dem Ersten Weltkrieg ein Chinesenviertel („Chineezenwijk“) im Hafenviertel Katendrecht, einer künstlich geschaffenen kleinen Halbinsel auf der linken, stadtabgelegenen Seite der Maas.22 Auch hier eröffneten Chinesen Unterkünfte und Lokale und begründeten die - mit 1.300 statistisch erfassten Personen (1931) - damals größte chinesische Kolonie in Europa.23 Es entwickelte sich eine eigene ethnische Infrastruktur, die im Kern US-amerikanischen Chinatowns ähnelte und vom Lokal, Geschäft, Spielsalon bis zum Friseur viele Bedürfnisse des Alltags befriedigte.

Titelseite einer Foto-Reportage der Zeitschrift „Het Leven“ über das Chinesenviertel in Rotterdam 1922
(Quelle: Gemeentearchief Rotterdam)
Die Entwicklung der chinesischen Migration nach Westeuropa verlief jedoch nicht gleichmäßig; der Erste und der Zweite Weltkrieg stellten jeweils eine erhebliche Zäsur dar. Während die Beschäftigung chinesischer Seeleute in den Niederlanden und in England nach 1914 kriegsbedingt zunahm, galten die 300 in Bremerhaven und Hamburg festsitzenden chinesischen Seeleute als eine Art Faustpfand auf deutscher Seite.24 Die Chinesische Republik blieb anfangs neutral, gewährte seit 1916 aber die Anwerbung chinesischer Vertragsarbeiter durch die britischen und französischen Kriegsparteien. Insgesamt wurden über 130.000 chinesische „Kulis“ angeworben, die hinter der Front in Frankreich Schanzarbeiten verrichten oder in Fabriken arbeiten sollten.25 Etwa 2.000 von ihnen blieben nach Kriegsende in Europa und siedelten sich in Paris an, wo um den Gare de Lyon eine gewisse Konzentration von Händlern entstand, oder gingen in andere europäische Länder.26 Während des Zweiten Weltkrieges wurden dann über 5.000 chinesische Seeleute in der britischen Handelsschifffahrt beschäftigt, die die Versorgung des Landes sicherzustellen halfen. Rund ein Fünftel von ihnen desertierte in New York und tauchte in der dortigen chinesischen Community unter.27
5![]()
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die chinesische Migration in Westeuropa sehr temporär und fluktuierend. Der häufige Grenzübertritt war die Regel und nicht die Ausnahme; viele chinesische Migranten wechselten regelmäßig ihren Wohnort zwischen den verschiedenen Hafenstädten. Entlang familiärer und persönlicher Kontakte organisierten chinesische Migranten (wie beispielsweise die Familie Ng mit ihren boarding houses in den Niederlanden und England) ihren Aufenthalt und Alltag. So konnten sie in einer ihnen fremden Umgebung Arbeit und Unterkunft finden. Ein gutes Beispiel für die Kommunikation untereinander ist die Erfolgsgeschichte chinesischer Erdnusskuchenverkäufer (pindaventer) in niederländischen Städten. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise seit 1929 hatte die Zahl arbeitsloser chinesischer Seeleute in Rotterdam erheblich zugenommen.28 1931 kam der arbeitslose chinesische Seemann Ng Kwai auf die Idee, sich mit dem mobilen Verkauf selbstproduzierter Kuchen seinen Lebensunterhalt zu verdienen.29 Dies fand viele chinesische Nachahmer, zumal die niederländische Bevölkerung den Händlern wohl auch aus Mitleid Kuchen abkaufte. Nach einiger Zeit kamen Chinesen aus dem benachbarten Ausland in die Niederlande, um am Erfolg der wirtschaftlichen Nische teilzuhaben, was schließlich zu einem Überangebot führte.
Neben der Gruppe der Seeleute aus Guangdong gab es eine andere kleinere Gruppe chinesischer Straßenhändler aus Qingtian in der Provinz Zhejiang, die chinesische Waren wie etwa Porzellan verkauften.30 Wegen ihrer hohen Mobilität und häufig unvollständigen Dokumente wurden sie für lokale und nationale Behörden in Westeuropa zum Problem. Eine gänzlich andere Gruppe chinesischer Migranten waren Studenten, die der Elite des Landes entstammten und nichts mit proletarischen Seeleuten und Straßenhändlern gemeinsam hatten. Neben Japan waren bei ihnen vor allem die USA, England und Frankreich sehr beliebte Zielländer, gerade auch die dortigen Metropolen. In Berlin entstand in den 1920er-Jahren eine vergleichsweise große Kolonie von 500 chinesischen Studenten.31 Eine offensichtliche chinesische Prägung wie in den westeuropäischen Hafenstädten gab es in Berlin trotz einer Vorliebe der Studenten für Charlottenburg nicht. Es existierte jedoch ein Treffpunkt chinesischer Straßenhändler nahe des Schlesischen Bahnhofs und in der unmittelbaren Nachbarschaft eines chinesischen Importeurs.32 Die chinesische Migration war bei aller Heterogenität vor allem maritim geprägt, und die Chinesenviertel in den europäischen Hafenstädten riefen auch die stärksten Reaktionen hervor.
2. Imaginationen: Gesellschaftliche und behördliche Reaktionen
Europäische Vorstellungen von China und Chinesen haben eine lange Geschichte.33 Die chinesische Arbeitsmigration dominierte im 19. Jahrhundert zunehmend die westliche Wahrnehmung. Mit der Auswanderung in die Neue Welt nahm auch das europäische Interesse an chinesischer Migration deutlich zu. Der deutsche Geograph Friedrich Ratzel legte bereits 1876 eine Studie über chinesische Migranten insbesondere in den USA vor, die er - im Gegensatz zu Schwarzen und Indianern - als sehr gute Arbeitskräfte charakterisierte.34 Der „Kuli“35 avancierte zum schillernden Inbegriff des chinesischen Arbeitsmigranten. Während Unternehmer den Kuli herbeisehnten, setzten Arbeiter und Sozialdemokraten ihn mit einem unterbezahlten und unpolitischen Tagelöhner gleich.
6![]()
Mit welchen Vorstellungen begegneten nun die westlichen Stadtgesellschaften den globalen Migranten, und welche lokalen Unterschiede gab es dabei? In England war die Polizei in ihren Berichten recht unaufgeregt, da ausländische und auch „farbige“ Seeleute in großen Hafenstädten wie London und Liverpool zum gewohnten Bild der maritimen Metropole gehörten. Selbst der behördlich bekannte Konsum von Rauchopium war bis ins frühe 20. Jahrhundert kein Anlass für strenges polizeiliches Vorgehen - schließlich war Opium im England des 19. Jahrhunderts weit verbreitet. In den Jahren nach 1900 änderte sich diese Sichtweise aber, was auch an den vehementen anti-chinesischen Kampagnen der englischen Seeleutegewerkschaft (NSFU) lag.36 Aus der englischen Nachbarschaft in Limehouse kamen nun gehäuft Proteste gegen die chinesische Einwanderung. Ein Leserbriefschreiber fürchtete 1908 gar, die Chinesen würden alsbald die Kontrolle im Bezirk übernehmen.37 Die räumliche Konzentration der Chinesen im Arbeiterwohnviertel ließ sie - bei gleichzeitiger Konkurrenz auf dem globalen seemännischen Arbeitsmarkt - in englischen Augen als fremde und gefährliche Eindringlinge erscheinen.
Eine Zuspitzung fand der koloniale Blick auf chinesische Migranten nach dem Ersten Weltkrieg. Viele chinesische Seeleute waren arbeitslos und galten als ernsthaftes Problem, weshalb die Polizei viele von ihnen des Landes verwies. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung war Kriminalität nun zentral. Es wurde kolportiert, dass vor allem der Chinese Brilliant Chang große Teile des illegalen Drogenhandels kontrolliere - als vermeintlicher „Dope King“ im London der 1920er-Jahre erlangte er eine beträchtliche mediale Prominenz.38 Beweise für die Beschuldigungen konnte die Metropolitan Police bis auf eine kleine Menge Kokain nicht erbringen; dennoch wurde er zu einer längeren Gefängnisstrafe und anschließender Ausweisung verurteilt. Chang war eine Provokation für die koloniale Hierarchie, da er sich ganz als Dandy gerierte, der sich im Pelzmantel mit jungen englischen Frauen an seiner Seite im Nachtleben der Metropole zeigte. Sexualität war hier unverkennbar zentral für die gesellschaftlichen Imaginationen, und chinesische Männer wurden zu einer Projektionsfläche gesellschaftlicher Verunsicherungen. Migranten wie Chang per-sonifizierten den unerwünschten „Eindringling“, der sich nicht länger an die kolonialen Regeln des britischen Empires halten wollte.

„Brilliant“ Chang nach seiner Festnahme in Hongkong 1935
(Quelle: Nationaalarchief Den Haag, 2.09.22, 16582)
Auch in Hamburg war die Wahrnehmung chinesischer Seeleute und Migranten symbolisch stark aufgeladen. Mit Blick auf einen aus England eingewanderten Chinesen, der Verwandte in Hamburg besuchte und anschließend ohne Genehmigung eine Gaststätte erwarb, schrieb die Polizei 1921 apodiktisch: „Die dauernde Niederlassung von derartigen fremdstämmigen Ausländern ist nicht erwünscht. Sie muß nicht nur im sanitären, sondern auch im allgemeinen deutschen Interesse [...] mit allen Mitteln verhindert werden.“39 Die Polizeibehörde konstruierte eine hygienische Gefahr für die Stadtbevölkerung und sorgte 1925 für eine Verschärfung des Hafengesetzes, die sich insbesondere gegen eine chinesische Einwanderung richtete. In Hamburg gab es nach der verheerenden Choleraepidemie von 1892 einen lang anhaltenden Hygienediskurs, im Zuge dessen Institutionen wie der Hafenarzt (1892) und das Hafenkrankenhaus (1900/01) geschaffen wurden. Die Kategorie „Rasse“ war in diesem Diskurs konstitutiv, vor allem hinsichtlich osteuropäischer Auswanderer und „farbiger Seeleute“.40
7![]()
In Rotterdam war die Ablehnung gegenüber einer dauerhaften chinesischen Einwanderung ebenfalls sehr ausgeprägt. Die Polizei erkannte die Forderung niederländischer Reedereien nach einem „Reservoir“ chinesischer Seeleute zwar grundsätzlich an, wollte die Zahl chinesischer Migranten aber begrenzen. Ebenso wie in Hamburg sahen die Rotterdamer Behörden ihre Hafenstadt als potenzielles „Einfallstor“ und empfanden deshalb eine nationale Verantwortung. Um einen besseren Überblick zu erhalten, führten sie 1926 eine monatliche Zählung der Chinesen (Chineezentelling) ein, die bis in die 1960er-Jahre fortgesetzt wurde.41 Gerade die große Dichte in den Unterkünften für chinesische Seeleute wurde in den 1920er-Jahren zunehmend kritisiert; die Behörden wurden aufgefordert, diese Missstände zu beseitigen.42 Zudem hatte die Weltwirtschaftskrise ab 1929 erhebliche Auswirkungen auf die Schifffahrt und senkte die Nachfrage nach seemännischen Arbeitskräften. Die Chinesische Vereinigung in den Niederlanden rief deshalb in einem Rundbrief dazu auf, wegen der schwierigen Lage nicht mehr nach Rotterdam zu kommen.43 Die Rotterdamer Polizei führte seit 1929 zahlreiche Ausweisungen durch - vor allem nach Batavia in Niederländisch-Indien -, die meist ältere, chinesische Seeleute ab 50 Jahren betrafen.44 Seit den 1930er-Jahren nahm die Zahl der Chinesen dann kontinuierlich ab, bis das maritim geprägte Chinesenviertel in der Nachkriegszeit sukzessive verschwand. In Hamburg kam ergänzend zur technischen Modernisierung der Seeschifffahrt noch eine Verfolgung chinesischer Männer während der NS-Herrschaft hinzu, die in einer „Chinesenaktion“ der Gestapo am 13. Mai 1944 gipfelte, nach der die restlichen 130 Chinesen monatelang als Objekte der staatlichen Rassenpolitik misshandelt wurden.45
Trotz rassistischer Diskurse und Praktiken war chinesische Migration in westlichen Augen aber durchaus ambivalent - sie konnte sowohl abschrecken als auch faszinieren. Die kleinen Chinesenviertel übten zum Beispiel einen großen Reiz auf Journalisten und andere Sensationsbegierige aus. In London ging seit dem Ende des 19. Jahrhunderts eine Reihe von ihnen in das East End, um die dortigen „Fremden“ zu begutachten und „Reiseberichte“ über solche urbanen Expeditionen zu verfassen.46 Das Fremde in der eigenen Nachbarschaft wurde dabei meist unaufgeregt geschildert; Erzählungen von einer Bedrohung der Metropole durch die wenigen Chinesen waren im Gegensatz zur Tagespresse der 1920er-Jahre kaum zu finden. Das trifft gerade auch auf den Konsum von Opium zu, der die Journalisten neben fremden Sitten und Speisen besonders interessierte.47
In Hamburg hingegen wurde das Chinesenviertel in einer exotistischen Perspektive beschrieben. Der Heimatdichter Ludwig Jürgens berichtete etwa 1930 über die Schmuckstraße nahe der Großen Freiheit: „Haus bei Haus [...] ist von der gelben Rasse bewohnt, jedes Kellerloch hat über oder neben dem Eingang seine seltsamen Schriftzeichen. Die Fenster sind dicht verhängt, über schmale Lichtritzen huschen Schatten, kein Laut dringt nach außen. Alles trägt den Schleier eines großen Geheimnisses.“48 Bezeichnend für die gesellschaftliche Wahrnehmung chinesischer Migranten in Hamburg ist das Gerücht aus den 1920er-Jahren, die Chinesen in St. Pauli hätten ein geheimes Tunnelsystem gegraben, das nur ihnen bekannt sei und das sie für ihre Schmuggelgeschäfte verwendeten. Dies korrelierte mit der Tatsache, dass die meisten Chinesen in Kellern wohnten oder dort ihre Geschäfte hatten - eine Behausung aus sozialen Gründen geriet zum passenden Ambiente für kriminelle Machenschaften. Bereits damals wurde die „Schauerballade“ über chinesische Geheimgänge in der Presse aber als frei erfunden bewertet.49 Arbeiterkinder in St. Pauli machten sich die Fremdheit der Chinesen anderweitig zunutze: Für sie galt der Gang durch die Schmuckstraße als Mutprobe. Eine Zeitzeugin berichtete mir lebhaft über die damalige Aufforderung ihrer Mutter, nicht allein ins Chinesenviertel zu gehen: „Geh da nicht zur Schmuckstraße!“
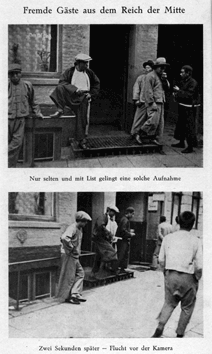
Suggestive Bildfolge von Ludwig Jürgens
(Quelle: Ludwig Jürgens, Sankt Pauli. Bilder aus einer fröhlichen Welt, Hamburg 1930, unpaginiert)
8![]()
Mit phantasievollen Darstellungen der kleinen europäischen Chinesenviertel ließ sich auch Geld verdienen. Schriftsteller entdeckten das Sujet bereits vor dem Ersten Weltkrieg; dabei war England wieder eindeutiger Schwerpunkt. 1911 recherchierte der Journalist Arthur Ward, später bekannt unter seinem Pseudonym Sax Rohmer, für ein Magazin über illegalen Opiumschmuggel und „Opiumhöhlen“ in Londons Limehouse. Ward/Rohmer kam auf die Idee, Unterhaltungsliteratur über chinesische Schreckensfiguren wie den mysteriösen Dr. Fu Manchu zu produzieren, die in den 1920er- und 1930er-Jahren in der gesamten westlichen Welt zum Bestseller avancierte und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.50 In seinen Romanen, die wiederholt im Londoner Chinesenviertel spielten, bediente sich Rohmer systematisch kultureller und „rassischer“ Zuschreibungen. Ein anderer bekannter englischer Autor war Thomas Burke, der ebenfalls über das Londoner Chinesenviertel schrieb und dabei auch die Figur des chinesischen Mannes mit einer sexuellen Vorliebe für junge „weiße“ Mädchen aufnahm.51
Der beträchtliche internationale Erfolg von Sax Rohmer motivierte weitere Schriftsteller, das „Erfolgsrezept“ von Kriminalität und Chinesenviertel einmal auszuprobieren. In Deutschland schrieb etwa der gelernte Buchhändler Alfons Zech den Roman „Begegnung auf der Landstraße“ (1936), in dem eine junge deutsche Frau in St. Pauli in die Fänge chinesischer Verbrecher gerät.52 Zech zeichnet das Bild einer chinesischen Unterwanderung Hamburgs, eines chinesisch dominierten Drogenhandels und rechtloser Zustände, die in der versuchten Verschleppung der deutschen Frau - gegen eine beträchtliche Menge Opium - nach China gipfeln. Zech schuf dezidiert nationalsozialistische „Unterhaltung“: Der versuchte Frauenhandel wird als ein Fall von „Rassenschande“ präsentiert und sollte umso schockierender wirken, als er sich inmitten einer deutschen Großstadt abspielte. In deutlichem Kontrast dazu stand der einzige Roman über Chinesen in den Niederlanden: In „Delistraat“ von G.J. Peelen, benannt nach einer Straße im Rotterdamer „Chinezenwijk“ Katendrecht, versucht ein niederländischer Pastor die Armut und Not der Chinesen zu lindern und bei dieser Gelegenheit möglichst viele Heiden zu missionieren.53 Nicht Fremdheit und Kriminalität, sondern Mitleid und Bekehrungsabsicht sind hier also die zentralen Themen. Nun wird man einige wenige Romane nicht als zuverlässige Quellen gesellschaftlicher Wahrnehmungen lesen dürfen; dennoch ist die Gegensätzlichkeit der literarischen Verarbeitungen erstaunlich und verweist auch auf divergierende gesellschaftliche Deutungsmuster.
In Filmen lassen sich ebenfalls Darstellungen chinesischer Migranten finden. Wie sehr Chinesen als Zeichen von Internationalität fungierten, zeigt exemplarisch der Spielfilm „Große Freiheit Nr. 7“ (1943/44) von Helmut Käutner mit Hans Albers und Ilse Werner in den Hauptrollen.54 Hannes Kröger alias Hans Albers verkörpert hier einen ehemaligen Seemann, der den maritimen singenden Entertainer in einem Amüsierbetrieb gibt und seine Melancholie mit Alkohol betäubt. In einer längeren Szene des Films spricht Kröger mit einem alten Kollegen über seinen dringlichen Wunsch, wieder zur See zu fahren. Das Ambiente bietet dafür ein chinesisches Lokal namens „Shanghai“ samt chinesischem Kellner. Es steht für die weltweiten Verbindungen der Hafenstadt Hamburg und der Seeschifffahrt insgesamt. Das „Shanghai“ ist das starke Symbol der maritimen Welt, nach der sich Hannes Kröger sehnt und die in Wahrheit doch nur der Fluchtpunkt seines persönlichen Scheiterns ist.
9![]()
Zur bereits erwähnten ambivalenten „Fremdheit“ chinesischer Migranten gehörte in der Zwischenkriegszeit nicht zuletzt eine touristische Attraktivität der Chinesenviertel. In London gab es organisierte Busreisen in die „Underworld“ des East Ends, für dessen exotische Aura auch die chinesische Präsenz in Limehouse herhalten musste. Eine enge Verbindung zwischen Chinesenviertel und ansteigendem Städtetourismus lässt sich ähnlich für St. Pauli konstatieren, was an der unmittelbaren Nähe zu den Hauptattraktionen von Reeperbahn und Großer Freiheit lag. Der Schriftsteller Hans Leip, bekannt durch seinen Text für den späteren Schlager „Lillie Marleen“, schrieb etwa 1927 über die Große Freiheit: „Da verkehren alle Nationen, plattdeutsch und englisch ist die Umgangssprache. Unter dem Maskenball der Reklameschilder, der Lock-laternen, dem Radau der Bandenmusik, der aus allen Türen birst, flutet an guten Abenden ein bemerkenswert einhelliges Gemisch dunkler, blonder, schwarzer, weißer und gelber Rassen. [...] Um die Ecke beginnt sich ein seltsames Chinesenviertel zu bilden. An anderer Stelle gibt es ein Lokal für mohamedanische Neger. Dieses St. Pauli meint der Fremde [...].“55 An derartigen Beschreibungen gab es bereits damals Kritik. Der Journalist Erich Lüth etwa meinte, St. Pauli werde von vielen aufgrund einer „falschen Romantik“ durch eine getönte Brille gesehen.56 Seinen Lesern empfahl er, chinesische Lokale nicht mit lärmenden Gruppen aufzusuchen und das „Opernglas“ zu Hause zu lassen.57 Er reagierte mit diesen Ratschlägen auf eine offensichtlich verbreitete Neugierde gegenüber Chinesen in St. Pauli, die auch im fasziniert-exotistischen Blick vor allem „Fremde“ blieben.
Die Chinesenviertel waren andererseits nicht vollständig gegenüber der einheimischen Bevölkerung abgeschottet. Da die chinesische Migration in diesem frühen Stadium fast ausschließlich männlich war, bildeten sich etliche Partnerschaften mit europäischen Frauen aus der Arbeiterschaft. Vor allem chinesische Gastronomen lebten mit einheimischen Frauen zusammen, die häufig in ihren Lokalen mitarbeiteten und mit den Behörden kommunizierten. Zudem suchten einige Intellektuelle, Künstler und Buddhisten den Kontakt zu chinesischen Migranten, um sich mit ihnen auszutauschen oder zumindest neue kulinarische Erfahrungen zu machen. Dieser Aspekt gewann nach dem Zweiten Weltkrieg eine größere und neuartige Bedeutung.
3. Kulinarische Globalisierung:
Chinesische Migration und Gastronomie nach 1945
Infolge des Zweiten Weltkriegs veränderte sich die chinesische Migration in Europa grundlegend. Die Chinesenviertel in Hafennähe existierten alsbald nicht mehr - wegen des Bombenkriegs (London), der NS-Verfolgung (Hamburg) und vor allem der Modernisierung der Seeschifffahrt (Rotterdam und andernorts). Mit der Gründung der Volksrepublik China und der Chinesischen Republik Taiwan 1949 gab es für chinesische Migranten zudem gänzlich andere Rahmenbedingungen. Über die britische Kolonie Hongkong gelangten viele chinesische Flüchtlinge, unter ihnen auch vermehrt Frauen, nach Großbritannien und später ins übrige Europa. Zwischen 1946 und 1962 lag die Zahl chinesischer Einwanderer ins Vereinigte Königreich bei rund 30.000 Menschen, die sich in den großen Städten des Landes und vor allem in der Metropole London konzentrierten.58
10![]()
Die kontinuierlich steigende Zahl chinesischer Migranten war durch Veränderungen der britischen Gesellschaft bedingt. In den Großstädten entstand ein Bedarf an ethnischer Küche, der in diesem Stadium neben Indern vor allem von Chinesen bedient wurde. Neben dem Wunsch nach kulinarischer „Internationalität“ konnten die nahrhaften Speisen, großen Portionen und langen Öffnungszeiten immer mehr Briten überzeugen. Die Gastronomie entwickelte sich zum zentralen wirtschaftlichen Betätigungsfeld chinesischer Migranten, die meist Arbeiter- und Bauernfamilien entstammten, nun aber auch zunehmend ausgebildete Köche waren. Chinesische Gastronomie stellte wegen ihrer ethnischen Ausrichtung keine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt dar und unterschied sich damit wesentlich von der Situation in der Schifffahrt der Vorkriegszeit. In den 1950er Jahren setzte ein regelrechter Boom chinesischer Gastronomie ein, und in den 1960er-Jahren gab es bereits 150 bis 200 chinesische Restaurants in London.59 Ein „Erfolgsrezept“ der europäischen Aneignung chinesischer Küche war, dass die Köche die Speisen dem westlichen Geschmack anpassten, das Gemüse weicher kochten und reichlich Saucen servierten. Authentische chinesische Küche, die häufig nach den vier Himmelsrichtungen unterschieden wird, war in diesem Zeitraum selten zu finden.60 Der Erfolg chinesischer Gastronomie ermöglichte eine Kettenmigration, die wiederum die räumliche Ausdehnung im Stadtgebiet forcierte. Der englische Anthropologe James L. Watson hat die sozialen Netzwerke chinesischer Migranten zwischen Hongkong und London eingehend untersucht und dabei die herausragende Bedeutung familiärer Bande unterstrichen.61 Chinesische Migranten bewegten sich meist in einer abgeschlossenen Welt; die Gastronomie führte wegen der langen Arbeitszeiten zu einer Isolation und ließ - bis auf die professionellen Kontakte von Kellnerinnen und Kellnern - kaum Berührungspunkte mit der britischen Gesellschaft zu.
Der Erfolg chinesischer Küche war nicht auf London begrenzt. Seit den 1950er-Jahren erfasste die Globalisierung chinesischer Küche, von den Großstädten ausgehend, sukzessive ganz Westeuropa.62 So entwickelte sich auch in niederländischen Städten ein Boom chinesischer Gastronomie, der vor dem Hintergrund der eigenen kolonialen Vergangenheit stattfand.63 Hier entstand die Mischform des „Chinees-Indisch restaurant“, das eine kombinierte Küche anbot und auch von Migranten aus der ehemaligen Kolonie Niederländisch-Indien (seit 1949 das unabhängige Indonesien) betrieben wurde. In niederländischen Städten wurde der Gang in eines der (im Jahr 1960) über 200 Lokale immer populärer, die nun im Gegensatz zu den „Pinda-Chineezen“ der Vorkriegszeit nicht auf einen Mitleidsfaktor setzen mussten.
Während ethnische Küche in englischen und niederländischen Großstädten aufgrund der längeren und ausgeprägteren kolonialen Vergangenheit und Erfahrung weniger irritierend war, zeigt die gleichzeitige Erfolgsgeschichte in der Bundesrepublik, dass sie allgemein ein Aspekt der entstehenden globalisierten, westlichen Konsumgesellschaft war.64 In Westdeutschland war Hamburg wegen der Traditionen und Bilder der Hafenstadt Vorreiter der Ausbreitung von China-Restaurants.65 Gab es 1950 nur 5 chinesische Lokale, so stieg die Zahl in den 1960er-Jahren auf mindestens 30. Das 1953 gegründete, von einem Chinesen und einem Deutschen betriebene „Tunhuang“ - nach der chinesischen Stadt Suzhou in der Provinz Jiangsu benannt - war wegen seiner professionell ausgebildeten Köche, der exquisiten Gerichte und der Inneneinrichtung besonders stilbildend.
„Die Küchen der Welt in unserer Stadt“: Beilage des Hamburger Abendblatts, 21.6.1972
(Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.)
11![]()
Den großen Erfolg chinesischer Küche illustriert eine farbige Zeitungsbeilage über „ausländische Restaurants“ in der Hamburger Innenstadt, die 1972 sowohl die Vielzahl der mittlerweile vorhandenen Lokale als auch die Dominanz chinesischer Küche zeigte.66 Die Hamburger Politik erkannte bereits in den 1960er-Jahren den kulturellen Standortvorteil chinesischer Restaurants und intervenierte gegen die restriktive bundesdeutsche Ausländerpolitik, die es chinesischen Gastronomen erschwerte, geeignetes chinesisches Personal zu finden und so die weitere Ausbreitung der China-Restaurants gefährdete.67 Die bundesdeutsche Ausländerpolitik sah lediglich die Anwesenheit europäischer Arbeitskräfte vor, was häufig euphemistisch als „Europäer-Grundsatz“ umschrieben wird, in Wirklichkeit jedoch einen Ausschluss nichteuropäischer Migranten bedeutete, die in den Akten der Bundesbehörden bis 1963 zudem noch das bizarre Etikett „Afro-Asiaten“ erhielten.68 Chinesische Köche wurden von bundesdeutschen Behörden höchstens als „Fachkräfte“ ins Land gelassen, wobei das Generalkonsulat in Hongkong sehr genau auf Einhaltung der Ausnahmeregeln achtete.69

Einblick in das gehobene Ambiente des „Tunhuang“ in der Hamburger Innenstadt 1956
(Quelle: Gerriet E. Ulrich, Mit Reiswein, Wodka und Campari, in: Hamburger Journal 4 [1956], Nr. 20, S. 18)
Trotz solcher Restriktionen breiteten sich China-Restaurants in vielen westdeutschen Großstädten aus und sorgten für einen weiteren Anstieg der chinesischen Migration.70 Chinesische Küche bediente auch in der Bundesrepublik sehr gut das wachsende gesellschaftliche Bedürfnis nach fremden kulinarischen Genüssen. Der Auslandstourismus der Westdeutschen seit den 1950er- und insbesondere den 1960er-Jahren eröffnete einen Erfahrungsraum, der die Aneignung fremder Küchen begünstigte. Der Besuch eines ausländischen Restaurants wurde auch als eine kulinarische Auslandsreise angesehen, für die praktischerweise die Heimatstadt nicht verlassen zu werden brauchte.
Chinesische Restaurants waren ein dezidiert urbanes Phänomen und galten europaweit als ein spezifischer Ausdruck kultureller Modernität. Zwar war der Zusammenhang zwischen ethnischer Gastronomie und den steigenden Zahlen chinesischer Migranten eigentlich nicht zu übersehen, doch trennten die Einheimischen das neue gastronomische Angebot in der Regel von seinem „Migrationshintergrund“ ab. Dies zeigen viele Presseartikel aus den 1950er- und 1960er-Jahren, die mitunter chinesische Gastronomen porträtieren, aber auf das Thema Migration nicht weiter eingehen. Gastronomen verkörperten den Typus des „nützlichen Ausländers“, der in scharfem Kontrast zu den Figurationen chinesischer Migranten vor 1945 steht. Während chinesische Einrichtungen zuvor als Orte von Kriminalität und Laster galten, erschienen sie nun als Dienstleistungstempel für die westliche Kundschaft. Wohl auch wegen der fast ausschließlichen Betätigung in der Gastronomie galten chinesische Migranten in Europa zudem nicht als ein Teil des „Ausländerproblems“, welches besonders durch die Ballung von Arbeitsmigranten in großstädtischen Sanierungsvierteln verortet wurde.
12![]()
So sehr die chinesische Gastronomie eine ethnische und wirtschaftliche Nische war, so sehr waren die Betreiber doch darauf angewiesen, sich über das Stadtgebiet zu verteilen, um nicht zu stark um dieselbe Kundschaft zu konkurrieren. Die Entstehung eines „Chinesenviertels“ war deshalb wenig ratsam. In London gab es seit den frühen 1960er-Jahren aber eine neue Ballung chinesischer Lokale - dieses Mal nicht im Osten der Stadt, sondern in der Gerrard Street im Vergnügungsviertel Soho. Dort eröffneten mehrere exklusive Restaurants, die den Kern einer in der Folgezeit entstehenden neuen „Chinatown“ bildeten.71 Die Behörden der englischen Metropole begleiteten die ethnische Ballung wohlwollend - zum einen, weil hier kein segregiertes Wohnviertel, sondern lediglich ein Geschäfts- und Freizeitzentrum entstand; zum anderen, weil sie sehr klar das touristische Potenzial erkannten, welches bis zum heutigen Tag eine Vielzahl von Besuchern anlockt. Die Gerrard Street ist darüber hinaus ein Symbol für die chinesische Community in Großbritannien und macht diese sichtbar.
Die chinesischen Lokale und wenigen räumlichen Konzentrationen der Nachkriegszeit waren sowohl Stätten der globalen Migration als auch der westlichen Imagination und Faszination. Dort, wo es keine Chinesenviertel mehr gab, merkten Beobachter wie der Immobilienbesitzer Wilhelm Bartels mit Blick auf St. Pauli an, dass solche Viertel „ein großer Anziehungspunkt für Touristen“ hätten werden können.72 „Fremdheit“ konnte in den postindustriellen Gesellschaften zu einem Marktvorteil werden, zu einem kulturellen und ethnischen Kapital.
Die Geschichte chinesischer Migranten in europäischen Metropolen demonstriert, wie „Fremde“ zur Gefahr für die nationale Arbeit und für die Großstädte stilisiert wurden; sie zeigt aber auch, wie Migranten wirtschaftliche Nischen besetzen und schließlich als kulturelle Bereicherung akzeptiert werden konnten. Chinesische Migranten fielen schon äußerlich selbst in den „international“ geprägten Hafenvierteln europäischer Großstädte auf. Chinesen ähnelten in dieser Hinsicht trotz ihrer vergleichsweise geringen Zahl Schwarzen und orthodoxen Juden. Als personifizierte „Fremde“ wurden Chinesen zu einem Testfall für die Metropolen; sie symbolisierten für Behörden und Bewohner die Gefahren globaler Migration, die nun in unmittelbarer Nachbarschaft bemerkbar würden. In Hamburg präfigurierte ein ausgeprägter Hygiene-Diskurs die vehemente Ablehnung, während sich in Rotterdam Indifferenz, Ablehnung und Empathie abwechselten. In London schlug die anfängliche Toleranz seit dem Ersten Weltkrieg in eine Abwehr um, die chinesische Männer als unerwünschte „Eindringlinge“ brandmarkte. In den 1950er- und 1960er-Jahren setzte mit dem großen Erfolg chinesischer Gastronomie eine vollkommen neue Phase chinesischer Migration ein, die nun als kulinarische Bereicherung der urbanen „Konsumgesellschaft“ allgemein anerkannt wurde. Während ein internationaler oder kosmopolitischer Charakter von westeuropäischen Metropolen seit den 1970er-Jahren als mehr oder minder selbstverständlich gilt, ist die Geschichte chinesischer Migranten in Westeuropa ein gutes Beispiel für den langen und unebenen Weg zur multikulturellen und multiethnischen Gesellschaft.
13![]()
Für die chinesischen Migranten selbst waren die wirtschaftlichen Chancen, die europäische Metropolen boten, der ausschlaggebende Grund für einen längeren Aufenthalt. Diejenigen, die mehrere Jahre in Europa lebten, passten sich schrittweise an das urbane, westliche Leben an. Dies lag auch an den vielen chinesisch-europäischen Partnerschaften in allen Untersuchungsorten. Aus chinesischer Sicht überwogen die Gemeinsamkeiten europäischer Bevölkerungen und Großstädte; trotz der lokalen und nationalen Unterschiede stellten diese für chinesische Migranten einen einheitlichen Raum dar. Leider gibt es nur wenige chinesische Egodokumente, die es erlauben würden, mehr über solche Wahrnehmungen zu erfahren.
1 Vgl. etwa Dirk Hoerder, Metropolitan Migration in the Past: Labour Markets, Commerce, and Cultural Interaction in Europe, 1600-1914, in: Journal of International Migration and Integration 1 (2000), S. 39-58; Martin Baumeister/Imke Sturm-Martin, Stadt und Migration in Europa. Aspekte einer vielschichtigen Wechselbeziehung, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte Nr. 2/2007, S. 98-111; für Großbritannien: David Feldman, Migration, in: Martin Daunton (Hg.), Cambridge Urban History of Britain, Cambridge 2000, S. 185-206; gelegentliche Hinweise auf Binnenwanderung und internationale Migration enthält auch Clemens Zimmermann, Die Zeit der Metropolen. Urbanisierung und Großstadtentwicklung, Frankfurt a.M. 1996.
2 Auch in der Migrationsforschung entwickelte sich „Magnetismus“ zu einem Erklärungsmodell - vor allem hinsichtlich der oft bemühten Push-and-Pull-Faktoren, die Migranten als historische Akteure und die wichtigen sozialen Netzwerke unberücksichtigt ließen. Vgl. Harald Kleinschmidt, Menschen in Bewegung. Inhalte und Ziele historischer Migrationsforschung, Göttingen 2002, S. 146.
3 Mit „Metropole“ sind hier also unterschiedlich große Großstädte gemeint. Um 1900 war London mit 6,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt, Hamburg hatte rund 705.000 und Rotterdam lediglich 280.000 Einwohner. Während London eine Metropole von globaler Bedeutung war, lassen sich Hamburg und Rotterdam zumindest als „maritime Metropolen“ bezeichnen.
4 Die westliche Konstruktion einer „gelben Gefahr“ verwies auf den militärischen Aufstieg Japans, die mögliche Industrialisierung Chinas und schließlich die weltweite chinesische Auswanderung. Siehe dazu immer noch die Studie von Heinz Gollwitzer, Die Gelbe Gefahr. Geschichte eines Schlagworts. Studien zum imperialistischen Denken, Göttingen 1962; zur verhängnisvollen Rolle des Schlagworts in den deutsch-amerikanischen Beziehungen siehe Ute Mehnert, Deutschland, Amerika und die „gelbe Gefahr“. Zur Karriere eines Schlagworts in der Großen Politik, 1905-1917, Stuttgart 1995.
5 Sebastian Conrad, Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich, München 2006, S. 168-228, untersucht neben anderen Beispielen auch den deutschen Blick auf chinesische Arbeiter, um den Einfluss der Globalisierung auf den wilhelminischen Nationalismus zu markieren. Zum Begriff „Kuli“ s.u., Anm. 35.
6 Siehe dazu die theoretischen Reflexionen von Sonja Haug/Edith Pichler, Soziale Netzwerke und Transnationalität. Neue Ansätze für die historische Migrationsforschung, in: Jan Motte/Rainer Ohliger/Anne von Oswald (Hg.), 50 Jahre Bundesrepublik - 50 Jahre Einwanderung. Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte, Frankfurt a.M. 1999, S. 259-284.
7 Vgl. allgemein Wang Gungwu, China and the Chinese Overseas, Singapore 1991; ders./Wang Ling-chi (Hg.), The Chinese Diaspora. Selected Essays, Singapore 1998; Lynn Pan, Sons of the Yellow Emperor. The Story of the Overseas Chinese, London 1990; für die USA siehe Madeline Yuan-yin Hsu, Dreaming of Gold, Dreaming of Home. Transnationalism and Migration Between the United States and South China, 1882-1943, Stanford 2001; für die große Bedeutung transnatio-naler Netzwerke siehe die gelungene Studie von Adam McKeown, Chinese Migrant Networks and Cultural Change. Peru, Chicago, Hawaii, 1900-1936, Chicago 2001; für Europa siehe die nach Staaten aufgeteilten Beiträge in Gregor Benton/Frank N. Pieke (Hg.), The Chinese in Europe, Basingstoke 1998.
8 Vgl. etwa Wang Gungwu, Don’t Leave Home. Migration and the Chinese, Singapore 2003; Ching-Hwang Yen, Coolies and Mandarins. China’s Protection of Overseas Chinese During the Late Ch’ing Period (1851-1911), Singapore 1985.
9 Vgl. Laura Tabili, „We Ask for British Justice“. Workers and Racial Difference in Late Imperial Britain, Ithaca 1994; Diane Frost (Hg.), Ethnic Labour and British Imperial Trade. A History of Ethnic Seafarers in the UK, London 1995.
10 Siehe Sibylle Küttner, Farbige Seeleute im Kaiserreich. Asiaten und Afrikaner im Dienst der deutschen Handelsmarine, Erfurt 2000; Hartmut Rübner, Lebens-, Arbeits- und gewerkschaftliche Organisationsbedingungen chinesischer Seeleute in der deutschen Handelsflotte. Der maritime Aspekt der Ausländerbeschäftigung vom Kaiserreich bis in den NS-Staat, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 33 (1997), S. 1-41.
11 Henk Wubben, „Chineezen en ander Aziatisch ongedierte“. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940 [„Chinesen und anderes asiatisches Ungeziefer“. Das Schicksal chinesischer Einwanderer in den Niederlanden, 1911-1940], Zutphen 1986; Ciska Brakenhoff, Tussen wal en schip: Chinese zeelieden en pindaventers in Nederland (1920-1940) [Zwischen Land und Schiff. Chinesische Seeleute und Hausierer in den Niederlanden, 1920-1940], Amsterdam 1984.
12 Für eine Geschlechtergeschichte der Seeschifffahrt im englischsprachigen Raum siehe Margaret Creighton/Lisa Norling (Hg.), Iron Men, Wooden Women. Gender and Seafaring in the Atlantic World, Baltimore 1996. Alltag und Stereotyp des chinesischen Wäschers in den USA untersucht Paul C.P. Siu, The Chinese Laundrymen. A Study of Social Isolation, hg. von John Kuo Wei Tchen, New York 1987.
13 Hier wie im Fall von „Chinatown“, das um 1850 in San Francisco entstand, war die Bezeichnung zunächst Ausdruck der westlichen Wahrnehmung. Vgl. Kay J. Anderson, Vancouver’s Chinatown. Racial Discourse in Canada, 1875-1980, Montreal 1991.
14 J.P. May, The Chinese in Britain 1860-1914, in: Colin Holmes (Hg.), Immigrants and Minorities in British Society, London 1978, S. 111-124; Colin Holmes, The Chinese Connection, in: Geoffrey Alderman/Colin Holmes (Hg.), Outsiders & Outcasts. Essays in Honour of William J. Fishman, London 1993, S. 71-93; Kwee Choo Ng, The Chinese in London, London 1968; David Parker, Chinese People in Britain: Histories, Futures and Identities, in: Benton/Pieke, Chinese in Europe (Anm. 7), S. 67-95.
15 Virgina Berridge/Griffith Edwards, Opium and the People. Opiate Use in Nineteenth-Century England, London 1981, S. 195-205; Terry M. Parssinen, Secret Passions, Secret Remedies. Narcotic Drugs in British Society 1820-1930, Manchester 1983, S. 52f., S. 115-125.
16 Maria Lin Wong, Chinese Liverpudlians. A History of the Chinese Community in Liverpool, Liverpool 1989; Joanne M. Cayford, In Search of ‚John Chinaman‘: Press Representations of the Chinese in Cardiff, 1906-1911, in: Llafur 5 (1991) H. 4, S. 37-50.
17 Siehe dazu ausführlich meine Studie: Fremde - Hafen - Stadt. Chinesische Migration und ihre Wahrnehmung in Hamburg 1897-1972, München 2006.
18 Wochenplauderei, in: Hamburger Echo, 1.9.1901.
19 Gesetz, betreffend die deutsch-chinesischen Vereinbarungen über die Wiederherstellung des Friedenszustandes vom 5.7.1921, in: Reichgesetzblatt 1921, S. 829-838.
20 Vgl. Ludwig Jürgens, Chinesenviertel, in: ders., Sankt Pauli. Bilder aus einer fröhlichen Welt, Hamburg 1930, S. 14-18; Chinesisches aus Hamburg, in: Hamburger Nachrichten, 15.1.1925; Die „gelbe Gefahr“ in St. Pauli, in: Deutsche Zeitung, 21.1.1925.
21 Vgl. Bart Zeven, Balancerend op de rand van Nederland: De Chinese minderheid in de jaren 1910-1940 [Balancierend auf dem Rand der Niederlande. Die chinesische Minderheit 1910-1940], in: Gregor Benton/Hans Vermeulen (Hg.), De Chinezen, Muiderberg 1987, S. 40-64; Wubben, „Chineezen en ander Aziatisch ongedierte“ (Anm. 11), S. 15-23.
22 Han Meyer, Operatie Katendrecht. ‚Demokratisering‘ van het sociaal beheer van de grote stad [Operation Katendrecht. ‚Demokratisierung‘ von sozialen Fragen in der Großstadt], Nijmegen 1983, bes. S. 37, stellt die überspitzte und nicht haltbare These auf, die Rotterdamer Behörden hätten im isolierten Katendrecht gezielt Chinesen angesiedelt, um sie dort besser kontrollieren zu können.
23 F[rederik] van Heek, Chineesche immigranten in Nederland [Chinesische Einwanderer in den Niederlanden], Amsterdam 1936; Evelyne Hurkmans, Chinezen in Rotterdam, 1911-1939. Een onderzoek naar beeldvorming [Chinesen in Rotterdam 1911-1939. Eine Untersuchung von Bildern und Vorstellungen], phil. Diss. Rotterdam 1996.
24 Siehe meinen Aufsatz: Vorstellungen und Nachforschungen. Chinesische Seeleute, deutsche Frauen und bremische Behörden während des Ersten Weltkrieges, in: Peter Kuckuk (Hg.), Passagen nach Fernost. Menschen zwischen Bremen und Ostasien, Bremen 2004, S. 184-203.
25 Zum Begriff „Kuli“ s.u., Anm. 35; zum Sachverhalt vgl. Paul Bailey, From Shandong to the Somme: Chinese Indentured Labour in France During World War I, in: Anne J. Kershen (Hg.), Language, Labour and Migration, Ashgate 2000, S. 179-196; Michael Summerskill, China On the Western Front. Britain’s Chinese Work Force in the First World War, London 1982; P[iontchong] Wou, Les travailleurs Chinois et la grande guerre, Paris 1939.
26 Yu-Sion Live, The Chinese Community in France: Immigration, Economic Activity, Cultural Organizations and Representations, in: Benton/Pieke, Chinese in Europe (Anm. 7), S. 96-124.
27 Tony Lane, The Merchant Seamen’s War, Manchester 1990, bes. S. 162-174.
28 Mitte der 1930er-Jahre bezifferte der Sozialwissenschaftler Frederik van Heek die Zahl chinesischer Arbeitsloser landesweit auf 800 Menschen, deren Anwesenheit niederländischen Interessen entgegenstehe und die seines Erachtens ausgewiesen werden sollten. Van Heek, Chineesche immigranten (Anm. 23), S. 90.
29 Wubben, „Chineezen en ander Aziatisch ongedierte“ (Anm. 11), S. 146-150; zeitgenössisch: Lekka-lekka-pinda-pinda!, in: Het Leven. Geïllustreerd [Das Leben. Illustrierte] 28 (1933), Nr. 5. In den Niederlanden entstand auch ein populärer Schlager über die chinesischen Händler, der im Refrain ihren Verkaufsslogan „Lekka, lekka, pinda, pinda“ wiedergab und ein gutes Beispiel für den paternalistischen Blick auf die Chinesen ist.
30 Vgl. Mette Thunø, Moving Stones from China to Europe: The Dynamics of Emigration from Zhejiang to Europe, in: Frank N. Pieke/Hein Malle (Hg.), Internal and International Migration. Chinese Perspectives, Richmond 1999, S. 159-180; Charles Archaimbault, Boeren en Landlopers: Migranten uit Oost-China [Bauern und Landstreicher: Migranten aus Ostchina], in: Benton/Vermeulen, De Chinezen (Anm. 21), S. 22-26.
31 Thomas Harnisch, Chinesische Studenten in Deutschland. Geschichte und Wirkung ihrer Studienaufenthalte in den Jahren 1860 bis 1945, Hamburg 1999, S. 202-213; Hsi-Huey Liang, The Sino-German Connection. Alexander von Falkeshausen Between China and Germany 1900-1941, Assen 1978, S. 23-38; Dagmar Yü-Dembski, „China in Berlin“, 1918-1933. Von chinesischem Alltag und deutscher Chinabegeisterung, in: Kuo Heng-yü (Hg.), Berlin und China. Dreihundert Jahre wechselvolle Beziehungen, Berlin 1987, S. 117-130, hier S. 121-124; zeitgenössisch: Max Linde, Chinesische Studenten in Deutschland, in: Ostasiatische Rundschau 7 (1926), S. 234f.
32 Das Chinesenviertel von Berlin, in: Tägliche Rundschau, 5.7.1927.
33 Siehe Colin Mackerrass, Western Images of China, Oxford 1989.
34 Friedrich Ratzel, Die chinesische Auswanderung. Ein Beitrag zur Cultur- und Handelsgeographie, Breslau 1876.
35 „Kuli“ bezeichnete eigentlich eine ethnische Gruppe im westlichen Indien, wurde im Westen aber zunehmend auf alle chinesischen Arbeitsmigranten bezogen, während der Begriff in China auf unfreie Arbeiter begrenzt blieb. Aufgrund unklarer Rahmenbedingungen waren die mehrjährigen Verträge der „Kulis“ häufig eine Mischform aus freier und unfreier Arbeit. Vgl. zum Begriff Robert L. Irick, Ch’ing Policy Towards the Coolie Trade, 1847-1878, Taibei 1982, S. 2-5; aus sozialdemokratischer Perspektive Gustav Eckstein, Zur Kulifrage, in: Die Neue Zeit 1906/07, Nr. 43, S. 548-555.
36 Siehe Tabili, „We Ask for British Justice“ (Anm. 9); siehe auch die Erinnerungen des Gewerkschaftsfunktionärs Edward Tupper, Seamen’s Torch. The Life Story of Captain Edward Tupper - National Union of Seamen, London o.J. [1938].
37 To the Editor. Chinese in Limehouse, in: East End News, 8.9.1908.
38 Zu seiner Personifizierung mit dem entstehenden urbanen Drogenproblem vgl. Marek Kohn, Dope Girls. The Birth of the British Drug Underground, London 1992; zeitgenössisch: Dope King Sent to Prison. Brilliant Chang to be Deported to China, in: Daily Express, 11.4.1924.
39 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA/AA), Berlin, R 85831, Schreiben des Hamburger Polizeipräsidenten an die Senatskommission für die Reichs- und auswärtigen Angelegenheiten (Abschrift), 9.11.1921.
40 Richard J. Evans, Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910, Reinbek 1990. Siehe auch die programmatischen Ausführungen des ersten Hafenarztes und Leiters des Tropeninstituts Bernhard Nocht, Hamburg und die Hygiene, in: Journalisten- und Schriftstellerverein für Hamburg, Altona und Umgebung (Hg.), Unser Hamburg, o.O. [Hamburg] 1911, S. 52f.
41 Umfangreiche Unterlagen dazu befinden sich in GA Rotterdam, Gemeentepolitie Rotterdam (63), 3165.
42 Th. K. van Lohuizen, De Chineezen op Katendrecht en de Rotterdamsche logementenverordening [Die Chinesen in Katendrecht und die Rotterdamer Unterkunftsverordnung], in: Tijdschrift voor Stedebouw en Volkshuisvesting [Zeitschrift für Städtebau und Wohnungswesen] 9 (1928), S. 131-139.
43 GA Rotterdam, 444.01, 420/417, The Overseas Chinese Association, Holland: Circular Letter to Compatriots in China Not to Come to Holland, 21.6.1930 (Durchschlag, Übersetzung unbekannter Autorenschaft).
44 GA Rotterdam, 454.05, S1288; Wubben, „Chineezen en ander Aziatisch ongedierte“ (Anm. 11), S. 168-174.
45 Siehe dazu Amenda, Fremde - Hafen - Stadt (Anm. 17), S. 258-281.
46 Count E. Armfelt, Oriental London, in: George R. Sims (Hg.), Living London. Its Work and its Play, its Humour and its Pathos, its Sights and its Scenes, Bd. 1, London 1906, S. 81-86; Henry V. Morton, The Nights of London, 3. Aufl. London 1930, S. 44-48, S. 73-77, S. 124-128.
47 Berridge/Edwards, Opium and the People (Anm. 15); Virgina Berridge, East End Opium Dens and Narcotic Use in Britain, in: The London Journal. A Review of a Metropolitan Society Past and Present 4 (1978) H. 1, S. 3-28; James Greenwood, In Strange Company. Being the Experiences of a Roving Correspondent, London 1873, S. 229-238.
48 Jürgens, Chinesenviertel (Anm. 20), S. 17.
49 Chinesisches aus Hamburg, in: Hamburger Nachrichten, 15.1.1925. Auch der Journalist Philipp Paneth, Nacht über St. Pauli. Ein Bildbericht, Leipzig 1931, S. 78, kritisierte die Kriminalisierung chinesischer Migranten als überzogen und bezweifelte ihre bedeutende Rolle im Drogenschmuggel.
50 Vgl. exemplarisch Sax Rohmer, The Mystery of Dr Fu-Manchu, London 1913; siehe dazu Clive Bloom, Twentieth-Century Suspense. The Thriller Comes of Age, London 1990, S. 22-36.
51 Thomas Burke, Limehouse Nights. Tales of Chinatown, London 1917; siehe dazu Anne Veronica Witchard, The Dark Chinoiserie of Thomas Burke and the Perversity of Limehouse, phil. Diss. London 2003.
52 Alfons Zech, Begegnung auf der Landstraße. Ein Hamburger Roman aus dem Jahre 1928-29, Berlin 1936; siehe dazu meinen Aufsatz: Migration und Kriminalisierung. Das „Chinesenviertel“ in St. Pauli/Altona und der Unterhaltungsroman „Begegnung auf der Landstraße“ (1936) von Alfons Zech, in: Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte 46 (2005), S. 92-119.
53 G.J. Peelen, Delistraat. Roman uit de Chineezenwijk van Katendrecht [Delistraat. Roman aus dem Chinesenviertel von Katendrecht], Kampen 1938.
54 Siehe Timo Heimerdinger, „Große Freiheit Nr. 7“. Zur Popularität eines Filmes zwischen Musik, Milieu und Melodramatik, in: Kieler Blätter zur Volkskunde 34 (2002), S. 183-204; Michael Töteberg, Filmstadt Hamburg. Von Hans Albers bis Wim Wenders, vom Abaton zu den Zeise-Kinos: Kino-Geschichte(n) einer Großstadt, 2., überarb. u. erg. Aufl. Hamburg 1997, S. 84-91.
55 Hans Leip, Geleitwort, in: August Rupp, Hamburg, Berlin 1927, S. VII-XVIII, hier S. XVI.
56 Erich Lüth, Kleiner Führer durch Hamburg, Nauen o.J. [1932], S. 17.
57 Ebd., S. 20.
58 Bis 1962 und den dann eingeführten Kontrollmaßnahmen des „Commonwealth Immigrant Act“ war es Chinesen aus Hongkong und den umliegenden New Territories ohne Einschränkungen möglich, in das Vereinigte Königreich einzuwandern und dort zu arbeiten. Vgl. Karen Schönwälder, Einwanderung und ethnische Pluralität. Politische Entscheidungen und öffentliche Debatten in Großbritannien und der Bundesrepublik von den 1950er Jahren bis zu den 1970er Jahren, Essen 2001, S. 151ff.
59 Ng, Chinese in London (Anm. 14), S. 29. In den USA hatte bereits während des Zweiten Weltkriegs eine verstärkte gesellschaftliche Akzeptanz chinesischer Küche eingesetzt; vgl. John A.G. Roberts, China to Chinatown. Chinese Food in the West, London 1992, S. 148.
60 Vgl. allgemein Kwang-chih Chang (Hg.), Food in Chinese Culture. Anthropological and Historical Perspectives, New Haven 1977.
61 James L. Watson, Emigration and the Chinese Lineage. The Mans in Hong Kong and London, Berkeley 1975; ders., The Chinese: Hong Kong Villlagers in the British Catering Trade, in: ders. (Hg.), Between Two Cultures. Migrants and Minorities in Britain, Oxford 1977, S. 181-213. Kritik an Watson übt Christopher Driver, The British at Table, 1940-1980, London 1983, S. 80, und erkennt bereits für die Zeit vor den 1950er-Jahren ein ausgeprägtes Interesse der britischen Stadtgesellschaften an ethnischer Küche.
62 Jack Goody, Food and Love. A Cultural History of East and West, London 1998, S. 161-171. Die weltweite Ausbreitung chinesischer Gastronomie läuft quer gegen die Kritik der Globalisierung als Homogenisierung, ist aber ein auffälliger Aspekt der zunehmenden Verflechtung.
63 Boudewijn R. Rijkschroeff, Etnisch ondernemerschap. De Chinese horecasector in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika [Ethnische Unternehmerschaft. Chinesische Gastronomie in den Niederlanden und den USA], Capelle a.d. Ijssel 1998, bes. S. 53-60; Frank N. Pieke, De Restaurants, in: Benton/Vermeulen, De Chinezen (Anm. 21), S. 67-76; R. van der Sijde, Chinees-Indische restaurants, ’s-Gravenhage 1983.
64 Matthew Hilton, Consumerism in Twentieth-Century Britain. The Search for a Historical Movement, Cambridge 2003; Michael Wildt, Am Beginn der „Konsumgesellschaft“. Mangelerfahrung, Lebenshaltung, Wohlstandshoffnung in Westdeutschland in den fünfziger Jahren, Hamburg 1994; Maren Möhring, Gastronomie in Bewegung. Migration, kulinarischer Transfer und die Internationalisierung der Ernährung in der Bundesrepublik Deutschland, in: Comparativ 17 (2007) H. 3, S. 68-85.
65 Siehe dazu ausführlich Amenda, Fremde - Hafen - Stadt (Anm. 17), S. 323-346. Die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nachweisbare deutsche Bezeichnung „China-Restaurant“ ist aufschlussreich und überraschend präzise, da chinesische Lokale zunehmend kulturelle Repräsentationen des Landes abgeben sollten und eine dementsprechende Inneneinrichtung hatten. In anderen Sprachen gab es den semantischen Hinweis auf das Land nicht.
66 Die Küchen der Welt in unserer Stadt (Sonderbeilage), in: Hamburger Abendblatt, 21.6.1972.
67 Staatsarchiv (StA) Hamburg, 136-1, 699, Protokoll der Besprechung der Ausländerreferenten des Bundes und der Länder am 19./20.4.1967 in Goslar, S. 6.
68 Siehe Schönwälder, Einwanderung und ethnische Pluralität (Anm. 58), S. 257-277. Dokumente über zahlreiche Fälle chinesischer Migranten finden sich im Bundesarchiv (BA) Koblenz, B 106/31345, Bd. 1 und 2.
69 In der Öffentlichkeit wurde diese Haltung der Bundesrepublik auch spöttisch kritisiert; vgl. Asiatische Krippe, in: Spiegel, 18.11.1964, S. 79f., hier S. 79.
70 Gelbe Küche wird modern. Die deutsche Küche steht schon längst nicht mehr auf einem (Eis-)Bein, in: Rheinischer Merkur, 22.9.1961.
71 Siehe Anthony Shang, The Chinese in Britain, London 1984, bes. S. 28.
72 Wilhelm Bartels, „Das war auch das Schöne an St. Pauli“, in: Herbert Dombrowski, Das Herz von St. Pauli. Fotografien 1956, Hamburg 1997, S. 10-16, hier S. 11.
![]()

