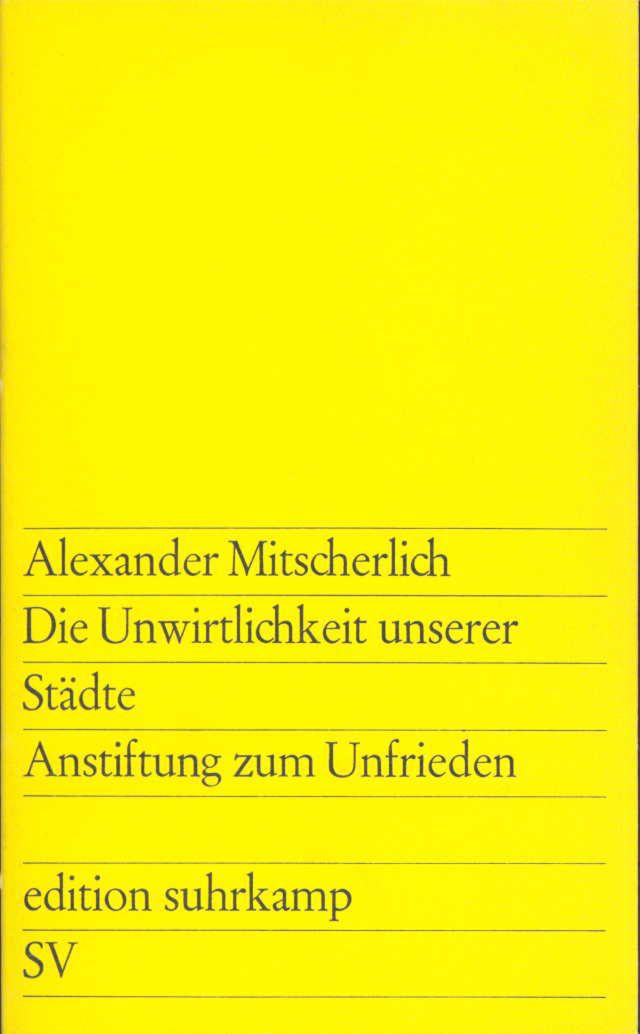Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1965, 27. Aufl. 2013. Die Seitenzahlen der Zitate im folgenden Text beziehen sich auf die Erstausgabe.
50 Jahre ist es nun her, dass Alexander Mitscherlichs Buch »Die Unwirtlichkeit unserer Städte« erstmals erschienen ist. Es umfasst mehrere Vorträge, die sich auf den bis dahin erfolgten Stadterneuerungsprozess bezogen. Mitscherlich betrachtete den Wiederaufbau nach 1945 als verpasste Chance. Besonderer Dorn im Auge waren ihm die städtebaulich dominanten, an funktionalistischen Prinzipien orientierten Strategien zur Entmischung des Stadtraums,[1] weil dies eine Bindung der Menschen an Räume behindere und weil der »Unsinn einer Entmischung« den Verfall städtischer Öffentlichkeit bewirke (S. 16; vgl. auch S. 79).
Mitscherlich richtete seine Kritik zum einen auf die »uniformierte Monotonie der Wohnblocks«, die im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus der 1950er-Jahre entstanden waren. Es handele sich hier um »soziale Slums«, »die einem in ihrer Monotonie an den Ausfallstraßen der Großstädte die Lektion erteilen, daß alles noch viel schlimmer ist, als man es sich einreden möchte« (S. 41; vgl. auch S. 13, S. 19). Die »bloß agglomerierte Stadt« könne keine Heimat werden, »denn Heimat verlangt Markierungen der Identität eines Ortes« (S. 15). Die Wohnblocks seien der »Inbegriff der Kapitulation vor der hohen Kopfzahl« (S. 19) und hätten zur Profillosigkeit urbaner Räume geführt. Speziell prangerte er die »Monotonie der Fensterreihung der meisten Hochhäuser und der starren Addition von Siedlungshäusern« an (ebd.).[2]
Seit den späten 1950er-Jahren gewann dann langsam der randstädtische Großsiedlungsbau an Fahrt, der allerdings erst im Laufe der 1960er-Jahre das Gesicht zahlreicher Großstädte bestimmen sollte.[3] Mitscherlich ließ sich in diesem Zusammenhang nicht vom euphorisch gestimmten und fordistisch orientierten Modernismus anstecken, obwohl damit weithin eine gesellschaftsbefreiende Abkehr vom Mief der 1950er-Jahre intendiert war.[4] Ihm ging es generell nicht um die Bewertung diverser städtischer Siedlungstypen per se, sondern um eine kritische Sicht auf konkrete Bauweisen. Und das betraf alle Siedlungstypen, die Trends zur Entmischung und Monotonie beförderten – auch die Großsiedlungen. In den »Trabantenstädten« lauere »die gähnende Langeweile«. Alles sei »artifiziell«. Den Großsiedlungen fehle es »an Strahlungskraft« (S. 81). Aus dem unter Stadtplanungskritikern damals gängigen, gegen Zersiedelung und Entmischung gerichteten Schlagwort »Urbanität durch Dichte« wurde de facto eine Stadtrand-Dichte ohne Urbanität,[5] eine Zusammenballung von Menschen, die »alle Widrigkeiten der Großsiedlungen« auf sich nehmen (S. 118).[6] Kurzum: Für Mitscherlich wurde die entmischte Stadt »zur Provinz, der citoyen, der Stadtmensch, zum bloßen Bewohner einer wenig rühmenswerten Gegend« (S. 16).
Zum anderen kritisierte Mitscherlich die Zersiedelung des Umlandes. »Die vernünftige Absicht, der immer unbewohnbarer gewordenen Stadt ins vorortliche Grün zu entfliehen, hat leider ihrerseits einem neuen Übel städtischen Daseins Vorschub geleistet.« (S. 53f.) Der sich verstärkende Zug ins vorstädtische, »gesichtslose« Eigenheim (S. 53) sei nicht der richtige Weg, weil dies die Bürger noch weiter von der Stadt entfremde. Mitscherlich sah demnach einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der unbewohnbar gewordenen Stadt und dem Fortzug vieler Menschen ins Umland.
Zwar konzedierte Mitscherlich, dass städtebaulich früher nicht alles besser gewesen sei, aber er fragte gleichwohl, wie die von ihm beschriebenen Fehlentwicklungen für die Phase nach 1945 erklärt werden könnten. Er fand darauf drei Antworten: Die Ursachen seien erstens der private Haus- und Grundbesitz, zweitens die reflexionslose Anpassung der Bewohner an die schlechten Wohn- und Lebensverhältnisse in der Stadt sowie drittens die Flucht zahlreicher Stadtbürger in die de-urbanisierte Einfamilienhaus-Kultur der Vororte. Nur der erstgenannte Grund war struktureller Art, während sich die zwei anderen Gründe nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, primär auf die Planer und deren Experten-Habitus bezogen, sondern auf das in Mitscherlichs Sicht allein sozialpsychologisch zu erklärende Verhalten der Stadtbewohner/innen.
Der von Mitscherlich in seiner Vorbemerkung als »Pamphlet« bezeichnete Text kam genau zur rechten Zeit, denn die Kritik an der modernen Stadt erhob sich damals von verschiedenen Seiten. Edgar Salin, Baseler Ökonom und Philosoph, hatte auf dem Deutschen Städtetag von 1960 in Aufsehen erregender Weise über das Thema Urbanität gesprochen. Jane Jacobs’ Buch »The Death and Life of Great American Cities« von 1961, das Mitscherlich kannte (S. 37), war 1963 in deutscher Sprache erschienen.[7] Hans Paul Bahrdt, Stadtsoziologe aus Göttingen, sah in seinem 1961 publizierten Buch »Die moderne Großstadt« die Polarität von Öffentlichkeit und Privatheit als Vorbedingung für urbane Lebendigkeit, die er in der modernen Stadt vermisste. Jürgen Habermas skizzierte 1962 in seinem Buch »Strukturwandel der Öffentlichkeit« das Bild einer durch Aufklärung emanzipierten frühbürgerlichen Stadtgesellschaft sowie deren aus seiner Sicht problematischen Wandel in den nachfolgenden Phasen. Und Wolf Jobst Siedler veröffentlichte 1964 den Bestseller »Die gemordete Stadt«, in dem er von seiner bürgerlich-konservativen Weltsicht aus, unterstützt durch eindrucksvolle Fotografien, »das Verlöschen des eigentlich Städtischen« beklagte und den Untergang der bürgerlichen Stadt der ordnungsorientierten, »perfektionierten Stadtplanung« anlastete.[8] Obwohl Mitscherlichs Vortragssammlung demnach kein singulärer Wurf war, trug sie ein eigenständiges Profil, wie im Folgenden gezeigt werden soll.
Ungeachtet der wenig strukturierten Darstellung und der zahlreichen Wiederholungen erlebte Mitscherlichs Buch viele Auflagen und ist noch heute lieferbar. Bereits bis 1970 wurde ungefähr die Hälfte der Gesamtauflage erzielt, die bis 1983 rund 200.000 Exemplare zählte.[9] In der Zeit vor, während und nach der Studentenbewegung ließ sich ein Buch, das den Untertitel »Anstiftung zum Unfrieden« trug, offenbar bestens vermarkten. Doch Mitscherlich war allenfalls zu Beginn der Studentenbewegung eine ihrer Leitfiguren; danach galt er in deren Augen, etwa in denjenigen von Hans-Jürgen Krahl und Peter Brückner, eher als »Papiervater« (so die abfällig gemeinte Bezeichnung auf einem Flugblatt).
Dieser »Papiervater« gehörte in den 1960er-Jahren zweifellos zu den führenden Intellektuellen und Repräsentanten, die die bundesrepublikanische Gesellschaft kritisch beäugten und über ihre Potentiale nachdachten. Mitscherlich genoss als Autor des Buchs »Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie« (1963) und des gemeinsam mit Margarete Mitscherlich verfassten Buchs »Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens« (1967) ein großes Renommee im In- und Ausland – zumal er es war, der die Psychoanalyse als Wissenschaft in der Bundesrepublik wieder etablierte und ihr in seiner Funktion als Direktor (1960–1976) des von ihm gegründeten Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main zu internationalem Ansehen verhalf.
Mitscherlichs Eintreten für eine neue Stadtgestaltung fand nicht nur in der Öffentlichkeit Anerkennung, sondern auch unter Experten. Zunächst schien es sogar, als ob sein Rat gefragt war, und Mitscherlich zeigte sich von der leichtgläubigen Seite, als er meinte, seine im Buch auch gegenüber den Großsiedlungen geäußerte Kritik durch bessere Planung überwinden zu können. Letztendlich musste Mitscherlich erfahren, wie wenig er trotz seines Engagements im Gestrüpp der Planungsstrategen und unter dem herrschenden Kostendruck tatsächlich bewirken konnte – etwa bei der Heidelberger Siedlung Emmertsgrund, die die Neue Heimat ab 1970 für rund 12.000 Menschen bauen ließ. Mitscherlichs diesbezügliche Vorstellungen zielten nicht nur auf die Schaffung von Kommunikationsräumen, sondern auch auf die Verbindung von Wohnen und Arbeiten. So sollte die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter verbessert werden, und es sollten Werkstätten für Rentner entstehen.[10] Doch von seinen Vorschlägen wurde nichts realisiert.[11]

(Wikimedia Commons/Foto: Christopher Jelen, Emmertsgrund Muellsauganlage 3, CC BY-SA 3.0)
Nachhaltiger war Mitscherlichs Wirkkraft wohl innerhalb der Wissenschaften, denn er hat die traditionelle konservative Stadtentwicklungskritik überwunden, gleichzeitig die kritische Stadtsoziologie wesentlich vorangebracht und ihr zu öffentlicher Anerkennung verholfen. Ferner mögen sich die in den 1970er-Jahren gegründeten Bürgerinitiativen bestärkt gefühlt haben, Kritik an Zuständen und Planungsvorhaben ihrer jeweiligen Städte zu äußern und dabei einen neuen, auf Partizipation abzielenden Bürgersinn zu kultivieren, wie dies seit April 1969 im Frankfurter Westend und später in zahlreichen anderen Städten zu beobachten war.[12]
Aus heutiger Sicht ist Mitscherlichs Buch in mehreren Punkten auffällig. Erstens ist seine stark psychologisierende Interpretation des Verhaltens der Bewohnerinnen und Bewohner zu nennen. In den Augen des Autors passten sich die Menschen an inhumane räumliche Gegebenheiten an, denen er als »Prägestöcke« (S. 9) starke Wirkungen auf die menschliche Psyche zuschrieb – bis hin zur Entstehung von Neurosen. Eine solche Engführung von Individualpsychologie und Stadtraumeffekten lag für den Psychoanalytiker Mitscherlich zwar nahe und war vielleicht auch dem neuen Zeitgeist geschuldet,[13] konnte sich aber als interpretatorisches Narrativ auf Dauer nicht durchsetzen.[14] Dies umso weniger, als das Wohnungsangebot noch immer knapp bemessen war und die Wohnungen der Großsiedlungen als relativ gut ausgestattet galten, weswegen die ErstbewohnerInnen trotz der monotonen Umgebung meist gern einzogen.
Zweitens machte Mitscherlich, wie schon erwähnt, hauptsächlich die privaten Haus- und Grundbesitzer für städtische Fehlentwicklungen und Immobilienspekulation verantwortlich. Er rückte seinen Lesern und Leserinnen die Tatsache ins Bewusstsein, dass eine potentielle Enteignung dieser Gruppen nicht einmal die Ebene einer öffentlichen Debatte erreichte, vielmehr stets tabuisiert blieb. So zutreffend diese Beobachtung war, so geriet hierbei leicht aus dem Blick, wie viel Macht auch die nicht-privaten, gemeinnützigen Wohnungsbau-Gesellschaften hatten (etwa die Neue Heimat). Sie handelten ebenfalls aus einem radikalen Effizienzdenken heraus, wie im Fall der Siedlung Emmertsgrund. Zudem vermittelte Mitscherlich den Eindruck (siehe etwa S. 21f.), dass er die Wissensmacht von Experten und Bürokraten unterschätzte, die im Kontext eines weit- und tiefgreifenden Sozialfordismus die Stadt neu ordnen und deren Bewohnerschaft dieser Ordnung anpassen wollten.[15] Bei einer Historisierung der 1960er-Jahre mag schließlich daran erinnert werden, dass die deutschen Kommunen insbesondere im Kaiserreich eine Politik verfolgten, die darauf hinauslief, möglichst viel Grund und Boden zu erwerben und auch die Daseinsvorsorge der Menschen zum Teil durch kommunale Eigenbetriebe zu gewährleisten (Munizipalsozialismus). Gestorben 1982, erlebte Mitscherlich nicht mehr, wie im Zuge des neoliberalen Zeitgeistes seit den 1980er-Jahren diese traditionsreiche Politik sukzessive aufgegeben wurde. Die Privatisierung galt fortan als Allheilmittel, so dass einflussreiches Investmentkapital immer häufiger ganze Stadtareale weitgehend nach eigenen Interessen formen konnte.
Drittens dokumentiert das Buch an verschiedenen Stellen ein Unbehagen des Autors an der städtischen Massengesellschaft, selbst wenn er diese Entwicklung als unausweichlich ansah.[16] Mitscherlich suchte in der Stadtkultur vergeblich nach einem »Gruppenkanon«, der dafür sorgen könne, »unsere Interessen eine Strecke weit denen der Gemeinde unterzuordnen«. Dieser Kanon fehle, »und deshalb verprovinzialisieren unsere Städte in Unwirtlichkeit, verfällt die städtische Hochkultur, die einmal Trägerin der Aufklärung war« (S. 20f.). Der »Unwirtlichkeit« der Städte hätten sich die Menschen angepasst – ohne ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Diese Behauptung ist, wie sich vor allem mit Blick auf die vielen Bürgerinitiativen im folgenden Jahrzehnt herausstellen sollte, stark verallgemeinernd und eine höchstens bis gegen Ende der 1960er-Jahre gültige Bestandsaufnahme. Sie übersieht auch die sonstigen eigenwilligen, ambivalenten Aneignungsformen: So nutzten Menschen die sich in den frühen 1960er-Jahren bereits abzeichnende Konsum- und Massen(freizeit)kultur nicht zuletzt für ihre (vermeintliche) Individualisierung der Raum- und Lebensgestaltung sowie zur Provokation tradierter Verhaltens- und Umgangsformen in der Stadtöffentlichkeit.
Auffällig ist viertens, dass in mehreren Textstellen die Mutter-Kind-Beziehung aufgegriffen und dabei auf die Freud’sche Entwicklungspsychologie rekurriert wird. Aus Mitscherlichs Sicht war allein die Mutter für das kleine Kind unersetzbar (S. 86ff.). Er vertrat implizit noch das damals dominante Leitbild einer Hausfrauenehe mit männlichem Haupternährer. Allerdings plädierte er zugleich bereits für urbane Funktionsmischungen und somit auch für die Schaffung kurzer Wege – eine Forderung, die im Zuge der Neuen Frauenbewegung meist erst in den 1970er-Jahren von Architektinnen und Stadtplanerinnen gestellt wurde.
Fünftens vermittelt Mitscherlichs Buch den Eindruck einer Idealisierung der alten, vom Bürgertum geprägten Stadt und der innerstädtischen Orte, »an denen die Bürger ihre Freiheit politisch nutzten und wahrten« (S. 76; vgl. auch S. 39). Der Autor – hier ähnlich wie Siedler – trauerte den verloren gegangenen »kulturellen Selbstverständlichkeiten der Zeiten vor der großen Menschenballung« nach (S. 139), ohne die miserablen Lebensbedingungen und die begrenzten Kommunikationschancen der breiten Bevölkerungsschichten jener Zeiten gebührend zu berücksichtigen. Auch ging Mitscherlich, wiederum implizit, von einer Stunde Null des Jahres 1945 aus – eine Sicht, bei der die Versäumnisse der Folgezeit noch stärker ins Licht rückten. Hinweise auf personelle Kontinuitäten unter den Stadtplanungsexperten und Architekten fehlen ebenso wie solche auf das konzeptionelle Erbe. Denken wir an das bereits in der NS-Zeit entworfene Konzept einer organizistisch aufgebauten Stadtlandschaft in Form einer »gegliederten und aufgelockerten Stadt«, das – nun vom NS-Kontext gelöst – auch im Nachkriegsdeutschland zum Leitbild avancierte.[17] Genauso wenig wurden die ordnungspolitischen Gestaltungsambitionen kritisch unter die Lupe genommen, die häufig mit dem Nachbarschaftskonzept[18] sowie mit den Altstadtsanierungen verbunden waren.[19]
Die Streitschrift von 1965 ist ein wichtiges Zeugnis radikaler Stadtkritik, das aus heutiger Sicht auch die Leerstellen im historischen und sozialwissenschaftlichen Forschungsstand der damaligen Jahre zeigt. Das Werk gilt, ähnlich wie Bahrdts Buch »Die moderne Großstadt«, mit Recht als einer der Marksteine, die zur Etablierung einer neuen kritischen Stadtsoziologie beigetragen haben. Angesiedelt im Spannungsfeld zwischen »elitären kulturkritischen Tendenzen und radikalem demokratischem Engagement«[20] liest sich Mitscherlichs Text zwar weithin als geschichtlich bedingte Klage über den Niedergang eines »stadtbürgerlichen Lebensbewußtseins« (S. 57), aber gleichzeitig auch als eindringliches Plädoyer für die Schaffung eines vielfältigen Stadtlebens und einer bürgerschaftlich getragenen Urbanität. Im Unterschied zu Siedlers Buch »Die gemordete Stadt« weisen Mitscherlichs Ausführungen sozialutopische Denkelemente auf, wie sie auch in Salins erwähntem Vortrag von 1960 enthalten waren. Eine »neue Urbanität«, so Mitscherlich, könne nur entstehen bei einer »Einschränkung des privaten Eigentumsrechtes an städtischem Grund und Boden« (S. 55). Die Fokussierung auf das Eigentumsrecht unterscheidet Mitscherlichs Buch ebenfalls von den genannten zeitgenössischen Stadtkritiken, während die »entmischte« Stadt auch von den anderen Autoren abgelehnt wurde. Die Besonderheit des Mitscherlich’schen Buches liegt schließlich, wie ansatzweise gezeigt wurde, in seiner sozialpsychologisch geprägten Auffassung: »Der Mensch wird so, wie die Stadt ihn macht, und umgekehrt.« (S. 16)[21] Dagegen helfe, so der Grundtenor des Buches, nur ein Mittel – eben die »Anstiftung zum Unfrieden«.
So bleibt das Buch bei der Relektüre ein relevantes Zeitdokument aus den mittleren 1960er-Jahren: Verfasst im Zenit der sozialfordistischen Moderne und der Neuen Sozialpsychologie, zeigt es zwar die dem Autor negativ erscheinenden Ausdrucks- und Wirkungsformen dieser Moderne auf, aber nicht deren historisch einzubettende Ambivalenzen. Ein Zeitdokument ist der Text auch insofern, als Mitscherlich hier den längst fälligen, für ihn jedoch wohl noch schmerzhaften Abschied vom klassischen Typ der Bürgertumsstadt nimmt, während seine Vorstellung von einer Stadt aktiver Bürger und Bürgerinnen – im Sinne von citizenship – noch eher visionär-konturenlos bleibt.
Anmerkungen:
[1] Gemeint ist damit die räumliche Trennung der Stadtareale für Arbeiten, Wohnen, Verkehr und Freizeit – entsprechend den Prinzipien der CIAM (Congrès Internationaux dʼArchitecture Moderne, 1928–1959).
[2] Mitscherlich dachte wohl an die Punkthochhäuser der 1950er-Jahre-Siedlungen, wie dasjenige des Hansaviertels in West-Berlin.
[3] Wohl deshalb hat Mitscherlich sich nicht so ausführlich über diesen Siedlungstyp geäußert.
[4] Die Verfasserin dieser Relektüre hat die Neubauten zunächst auch eher positiv konnotiert.
[5] Siehe u.a. Ulfert Herlyn/Wulf Tessin/Adelheid von Saldern (Hg.), Neubausiedlungen der 20er und 60er Jahre. Ein historisch-soziologischer Vergleich, Frankfurt a.M. 1987.
[6] Als Alexander Mitscherlich und seine Frau von Heidelberg nach Frankfurt zogen, bewohnten sie von 1968 bis 1979 ein weiträumiges Penthaus im 19. Stock eines Hochhauses. Da der Lift ohne Halt von der Tiefgarage bis zur Wohnung fahren konnte, fiel er als Kontaktzone weitgehend weg. Siehe Nikolaus Hirsch, Psychotop. Alexander Mitscherlichs Plan für die Freiheit, in: Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Neuaufl. Frankfurt a.M. 2008, S. 200-215, hier S. 200.
[7] Vgl. Johannes Novy, Die Entdeckung der »Mannigfaltigkeit«. Wie Jane Jacobs’ »Tod und Leben großer amerikanischer Städte« die Stadtforschung veränderte, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 4 (2007), S. 456-460.
[8] Siehe Vorwort und u.a. S. 11, S. 190. Als neuere Relektüren siehe Stephanie Warnke, Zur Kontextualisierung eines »Klassikers«. Wolf Jobst Siedlers und Elisabeth Niggemeyers Essay-Foto-Buch »Die gemordete Stadt«, in: Vittorio Magnago Lampugnani/Katia Frey/EIiana Perotti (Hg.), Zur Ideengeschichte des Städtebaus im Spiegel theoretischer Schriften seit dem 18. Jahrhundert, Berlin 2011, S. 139-152; Rainer Haubrich, Als Deutschland seine Städte in den Tod trieb, in: Welt, 13.3.2014.
[9] Walter Siebel, Alexander Mischerlichs Kritik der Stadt, in: Sibylle Drews (Hg.), Freud in der Gegenwart. Alexander Mitscherlichs Gesellschaftskritik, Frankfurt a.M. 2006, S. 103-126, hier S. 104; Tim Schanetzky, Anstiftung zum Unfrieden. Mitscherlich und die abstrakte Kunst des Städtebaus, in: Tobias Freimüller (Hg.), Psychoanalyse und Protest. Alexander Mitscherlich und die »Achtundsechziger«, Göttingen 2008, S. 95-108, hier S. 106. Ein Quellennachweis hinsichtlich der Auflagen fehlt allerdings bei allen Autoren. Der Suhrkamp-Verlag veröffentlichte 1976 die 13. Auflage. Die 9. Auflage im Jahr 1970 überstieg bereits die Höhe von 90.000 verkauften Exemplaren.
[10] Mitscherlich wollte hier auch flexible, untereinander verkoppelbare Wohneinheiten durchsetzen. Vgl. Hirsch, Psychotop (Anm. 6), S. 209f.
[11] Vgl. Schanetzky, Anstiftung (Anm. 9), S. 103.
[12] In diesem Zusammenhang ist auch an die vielschichtigen Hausbesetzungen zu denken. Ob die Bürgerinitiativen Mitscherlichs Buch ganz oder teilweise gelesen oder sich nur vom Titel haben anregen lassen, lässt sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls war die Rede von der »Unwirtlichkeit der Städte« in aller Munde, und die große Auflage des Buches gerade in den 1970er-Jahren lässt darauf schließen, dass es zumindest oft gekauft wurde. Vgl. hierzu Schanetzky, Anstiftung (Anm. 9), S. 96f.
[13] Zu denken ist hierbei an den damaligen Trend, Individuen als Subjekte zu sehen, deren Leid gesellschaftlich bedingt sei. Verursacht werde das damit einhergehende Spannungsgefüge dadurch, dass Individuen einerseits neurotisch wirkende Anpassungen an gesellschaftliche Gegebenheiten vornehmen würden, andererseits grenzüberschreitende Befreiungsschläge imaginierten.
[14] Marianne Rodenstein, »Die Unwirtlichkeit unserer Städte«: Kontext, Thesen und Konsequenzen, in: Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Neuaufl. Frankfurt a.M. 2008, S. 171-199, hier S. 184. Zu dieser Neuauflage siehe auch Dieter Bartetzko, Die Stadt, der Prägestock unseres Lebens, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.9.2008, S. 34; Klaus Englert, Die Unwirtlichkeit unserer Städte, in: Deutschlandfunk, 17.9.2008.
[15] Siehe u.a. Adelheid von Saldern/Rüdiger Hachtmann, Das fordistische Jahrhundert. Eine Einleitung, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 6 (2009), S. 174-185; Adelheid von Saldern, »Alles ist möglich.« Fordismus – ein visionäres Ordnungsmodell des 20. Jahrhunderts, in: Lutz Raphael (Hg.), Theorien und Experimente der Moderne. Europas Gesellschaften im 20. Jahrhundert, Köln 2012, S. 155-192. Zur Zweckrationalität des Fordismus im Kontext des Mitscherlich-Buchs siehe Siebel, Mitscherlichs Kritik der Stadt (Anm. 9), S. 105.
[16] Mitscherlich stand in den 1920er-Jahren dem republikfeindlichen Frontkämpferbund nahe, zeigte sich von Intellektuellen wie Ernst Jünger beeindruckt, verspürte einen starken Hang zur Eugenik und lehnte die Massendemokratie ab. In den 1930er-Jahren verband ihn einiges mit Ernst Niekisch, dem damals bekannten nationalbolschewistischen Schriftsteller, was ihm auch eine kurze Haftstrafe einbrachte. Erst danach wandte er sich dezidiert von solchen Intellektuellen ab und versöhnte sich einigermaßen mit der Massendemokratie. Siehe dazu Martin Dehli, Leben als Konflikt. Zur Biographie Alexander Mitscherlichs, Göttingen 2007; Timo Hoyer, Im Getümmel der Welt. Alexander Mitscherlich – ein Portrait, Göttingen 2008; Tobias Freimüller, Alexander Mitscherlich. Gesellschaftsdiagnosen und Psychoanalyse nach Hitler, Göttingen 2007.
[17] Entworfen wurde dieses Leitbild von Johannes Göderitz, Roland Rainer und Hubert Hoffmann.
[18] Dirk Schubert, »Heil aus Ziegelsteinen« – Aufstieg und Fall der Nachbarschaftsidee, in: Die Alte Stadt 25 (1998), S. 141-173.
[19] So wurde die meist verarmte, subproletarische Wohnbevölkerung solcher Areale vertrieben und ihr Kommunikationsgefüge zerstört. Vgl. Adelheid von Saldern, Häuserleben. Zur Geschichte städtischen Arbeiterwohnens vom Kaiserreich bis heute, Bonn 1995 (für die NS-Zeit und die Bundesrepublik S. 198-205 und S. 363ff.).
[20] Ludger Lütkehaus, Alexander Mitscherlich aus der Sicht der Enkelgeneration, in: Psyche 63 (2009), S. 231ff., hier S. 232.
[21] Vgl. dazu Beate Binder, Urbanität als »Moving Metaphor«. Aspekte der Stadtentwicklungsdebatte in den 1960er/1970er Jahren, in: Adelheid von Saldern (Hg.), Stadt und Kommunikation in bundesrepublikanischen Umbruchszeiten, Stuttgart 2006, S. 45-66, insbes. das Unterkapitel »Von der politischen Utopie vergangener Urbanität« und S. 54f.