Nach dem »heroischen Zeitalter« von Blockade, Luftbrücke, Mauerbau und Kennedy-Besuch war West-Berlin in den 1970er-Jahren eine Gesellschaft geworden, die zunehmend von Normalisierung und schließlich von Stagnation geprägt war. Die umfassenden Orientierungskrisen der damaligen westlichen Welt trafen das konsolidierte West-Berlin besonders scharf, zumal der Legitimationsbedarf der künstlichen, infolge der Entspannungspolitik scheinbar historisch ausgedienten Frontstadt besonders hoch war. Zahlreiche Probleme auf politischer, sozialer, städtebaulicher und wirtschaftlicher Ebene bündelten sich um 1980 zu einer manifesten Sinnkrise der »Insel«.[1]
In dieser Situation entdeckte West-Berlin, wie viele andere Großstädte auch, seine Innenstadt neu. Daraus resultierte zum einen die Internationale Bauausstellung (IBA) 1984/87, die mit ihrer »Behutsamen Stadterneuerung« Weichen stellte, und zum anderen eine neue Aufmerksamkeit für das frühere politische Zentrum der Metropole, das jetzt weitgehend Brachland war und von der Mauer durchschnitten wurde. Mitte der 1970er-Jahre hatte sich infolge des Vier-Mächte-Abkommens die Situation der deutschen Teilung weitgehend verfestigt; gleichzeitig entdeckten überall Bürger die Geschichte neu. Beides änderte die Perspektive auf die ehemalige Mitte Berlins. Zögerlich wandte sich der West-Berliner Senat dem Areal zwischen Reichstag, Kulturforum und früherem Prinz-Albrecht-Gelände zu – unter der Chiffre »Zentraler Bereich«. Obwohl dieser Teil des Stadtraumes bis zum Mauerfall 1989 letztlich weithin unbebaut blieb, wurde er durch intensive Untersuchungen und Debatten doch in Erinnerung gerufen, beschrieben und neu gedeutet. Daraus ergab sich Mitte der 1980er-Jahre eine bis dahin unbekannte »Geschichtslandschaft«, die als symbolisch aufgeladener »Ort« der verlorenen Nation und der Vergangenheit kodiert wurde. Dass Bundeskanzler Helmut Kohl hier den Grundstein für ein »Deutsches Historisches Museum« legte, war 1987 durchaus folgerichtig – und wäre doch nur wenige Jahre zuvor völlig undenkbar gewesen.
Dieser Aufsatz skizziert das West-Berliner place making in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre. Damit soll er zur historischen Rekonstruktion von Erfahrungsräumen und Zukunftshorizonten im politischen West-Berlin beitragen.[2] Zugleich ist der Aufsatz ein Versuch, dem nach 1990 gebauten »neuen« Berlin eine seiner vielen Vorgeschichten zurückzugeben. Diese Vorgeschichte führte keinesfalls zwingend zur heutigen Bundeshauptstadt. Allerdings stellten die Debatten der 1980er-Jahre einen breiten, von der eigentümlichen Situation der Inselstadt geprägten Wissensvorrat bereit, der ab 1990 plötzlich höchst relevant und oft handlungsleitend wurde.
Im Folgenden werde ich hauptsächlich städtebauliche Dokumente und planerische Diskussionen betrachten. Dass aus vielen der hier diskutierten Entwürfe und Vorschläge im Sinne von Baumaßnahmen zunächst einmal nur wenig geworden ist, spielt für ihre Aussagekraft als Quellen einer West-Berliner Selbstvergewisserung keine Rolle. Es geht vielmehr darum, wie sich das damalige West-Berlin über sich selbst, seinen Ort in der Geschichte und die Geschichte seiner Orte zu verständigen suchte. Welche Vorstellungen, Hoffnungen und Ängste verbargen sich hinter den stadtplanerischen Entwürfen? Welche Praktiken erschlossen und kodierten den Stadtraum? An welchen Orten verdichtete sich dieser Diskurs, und welche Materialität entwickelte er?
Den Ausgangspunkt bildet das West-Berliner Krisenjahr 1981, das viele Elemente von Stagnation und erzwungenem Aufbruch in sich vereinigte: den Untergang des sozialliberalen Senats im »Bausumpf«,[3] das kurze Interregnum von Hans-Jochen Vogel (SPD) als Regierendem Bürgermeister, die Eskalation der Gewalt in den Straßenschlachten zwischen Polizei und Hausbesetzern, aber auch den Regierungsantritt Richard von Weizsäckers (CDU), die aufsehenerregende Preußen-Ausstellung und die ersten öffentlichen IBA-Ergebnisdiskussionen.
1. Die Entdeckung der »Mitte«
im IBA-Expertenverfahren (1981)
Am Anfang stand die IBA. Die Internationale Bauausstellung 1984/87 war als eine Antwort auf das sich verändernde Berlin gedacht. Und sie veränderte ihrerseits die Stadt erheblich. Als das Zukunftsbild einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und damit auch Berlins immer weiter hinter dem Horizont verschwand, wurden die bisherigen städtebaulichen Koordinaten der Inselstadt allmählich obsolet. Die dichtbevölkerten, vormals zentral gelegenen Wohnviertel an der Mauer – in Kreuzberg, Tiergarten und Wedding – waren in eine Randlage geraten: Was sollte aus ihnen künftig werden? Das Provisorium wurde langsam permanent. Ohnehin stand der West-Berliner Bausektor stark zur Diskussion. Aus vielen Gründen verlor die klassische Methode von Abriss und Neubau, die (von den Gegnern) so genannte Kahlschlagsanierung, an Rückhalt. Auch das Europäische Jahr des Denkmalschutzes 1975 hatte hierzu beigetragen. In der Krisenzeit der späten 1970er-Jahre beschloss der sozialliberale Senat den Plan für eine neue Bauausstellung, nach den avantgardistischen Vorläufern von 1910, 1931 und 1957. Diesmal sollte sich das Projekt aber nicht auf futuristische Visionen richten, sondern auf den Umgang mit der alten Stadt, unter dem Motto »Die Innenstadt als Wohnort«. Die IBA war Teil einer städtebaulichen Wende, die schließlich zu einer Rehabilitierung der Berliner Mietskaserne führte. Wie andere europäische Städte auch, zeugte West-Berlin von einer Neu- oder Rückbesinnung auf die Altstädte; und zugleich stimulierte West-Berlin diesen internationalen Trend weiter. Dafür stand bald das Logo der IBA.[4]
Die Bauausstellung wurde aus der Not geboren, entwickelte sich dynamisch und blieb während ihrer Laufzeit von 1978/79 bis 1987 aus verschiedenen Gründen immer kontrovers. Erstens bestand das Team nur aus einigen dutzend Mitarbeitern, die außerhalb der riesigen Bauverwaltung operierten. Dieses Amt verkörperte mit seinem Image der Undurchschaubarkeit und Schwerfälligkeit für viele die Lethargie und Ideenarmut des angeschlagenen West-Berlins. Als kreative Elite-Einheit sollte die IBA eigentlich neue Impulse setzen – Konkurrenz aus der mächtigen Bauverwaltung war jedoch die Folge. Zweitens wurde, anders als bei früheren Bauausstellungen, nicht ein zusammenhängendes Demonstrationsgebiet in der Stadt bestimmt, sondern es wurden verschiedene Quartiere in Tiergarten und Kreuzberg ausgewählt, ergänzt um einige isolierte Projekte, die über die Inselstadt verteilt waren. Drittens fiel die IBA in zwei Komponenten auseinander: »IBA-Alt« und »IBA-Neu«. Die Altbau-IBA wurde in West-Berlins zurückgebliebenen Kiezen tätig, wo verfallene Mietskasernen renoviert werden sollten. Die Aufgabe der Neubau-IBA war es dagegen, in den bereits »kaputten« Teilen West-Berlins Neubauten zu realisieren, die sich an den historischen Blockstrukturen orientierten, ohne die »ursprüngliche« Stadt noch mehr zu beschädigen als ohnehin schon geschehen. Beide Abteilungen verabschiedeten sich somit von der weitläufigen Flächensanierung, um stattdessen in vielen kleinen Schritten die vorhandene Stadt mit neuen Einzelbauten zu ergänzen und infrastrukturell zu modernisieren.
Obwohl komplementär, wuchsen Alt- und Neubau-IBA im Laufe der Zeit deutlich auseinander. IBA-Neu suchte Anschluss an internationale Architekturdebatten, während IBA-Alt eher lokal verwurzelt war. IBA-Neu umfasste große Budgets, IBA-Alt arbeitete in armen Rückstandsgebieten. IBA-Neu konzentrierte sich im nördlichen Kreuzberg und Tiergarten auf Stadtteile, die durch Bomben und Abrissbirnen entleert worden waren, IBA-Alt auf die dicht bevölkerten und schlecht instand gehaltenen Quartiere im südöstlichen Kreuzberg (»SO36«). IBA-Neu gab sich kosmopolitisch und wurde von ihrem Direktor Josef Paul Kleihues (1933–2004) verkörpert, umstritten wegen seines flamboyanten Lebensstils. IBA-Alt war basisdemokratisch und wurde von ihrem Direktor Hardt-Waltherr Hämer (1922–2012) repräsentiert, der seine Legitimation aus breiter Bürgerbeteiligung und endlosen Diskussionsverfahren bezog, aber in bürgerlichen Kreisen der Zusammenarbeit mit Hausbesetzern verdächtigt wurde. Kleihues prägte Mitte der 1980er-Jahre den Begriff der »Kritischen Rekonstruktion«, der nach 1990 in der plötzlichen Bundeshauptstadt große Wellen schlug.[5] Hämer entwarf die berühmten »12 Grundsätze der Behutsamen Stadterneuerung«, die eine breite Bürgerbeteiligung vorsahen, Modernisierung vor Abriss stellten und 1983 als politische Grundsatzerklärung vom Abgeordnetenhaus übernommen wurden.[6] Trotz der Stilunterschiede und dann auch der persönlichen Differenzen zwischen beiden charismatischen Stadterneuerern war die dahinterliegende Einheit der IBA für jeden erkennbar. Beide Protagonisten gingen von der existierenden Stadt aus und nicht länger nur vom Zeichentisch, beide betrieben »Stadtreparatur«. Der Unterschied zu den modernistischen Jahren war groß.
1981 kam es allerdings zu einer ersten Kraftprobe, als der Niedergang der West-Berliner SPD, die die IBA maßgeblich gefördert hatte, das städtebauliche Experiment seines politischen Rückhalts beraubte. Zudem gab es trotz der reichlichen Subventionen große finanzielle Lücken und Ärger mit den eigensinnigen Direktoren, vor allem mit Kleihues. Dieser holte weltberühmte Architekten nach Berlin, zahlte ihnen große Summen Preisgeld und distanzierte sich demonstrativ vom West-Berliner Biotop. Das machte ihn in lokalen Kreisen unpopulär, vor allem in jenen der Altbau-IBA. Obwohl viele anerkannten, dass Kleihues West-Berlin vor dem allseits befürchteten Provinzialismus rettete, wurde er als Verschwender kritisiert – und mit ihm das gesamte Experiment der IBA.[7]
Im Sommer 1981 gelang Kleihues der Befreiungsschlag, als er völlig überraschend einen »Rahmenplan« für weite Teile der West-Berliner Innenstadt vorlegte. Bezeichnenderweise berichtete er nicht an seine Auftraggeber im Senat, sondern der Plan wurde zunächst vom Bonner Kunsthistoriker Tilmann Buddensieg in der (Hamburger) »ZEIT« öffentlich präsentiert.[8] Dies stellte den ersten kohärenten IBA-Bericht dar. Er bündelte einige länger diskutierte Einzelprojekte im Stadtbild, und da diese oft von Bürgerinitiativen mitgetragen wurden, waren hiermit nicht nur die Berliner Politik und Verwaltung angesprochen. Die IBA-Diskussion elektrisierte bald weite Kreise und rief eine Welle an Kreativität hervor. Das Thema verließ im Herbst 1981 die Spezialistenarena und wurde zeitweilig zum West-Berliner Tagesgespräch. Hier liegt der Beginn eines breiten Berliner Stadterneuerungsdiskurses, der weit in die 1990er-Jahre hinein fortwirkte.
(aus: Josef Paul Kleihues, Sieben Essentials zum Rahmenplan für die Neubaugebiete der Internationalen Bauausstellung Berlin, in: Bauwelt 72 [1981], S. 1589-1595, hier S. 1590f.)
Kleihuesʼ »Gesamtplan«, bald auch in der Berliner Presse und in Fachzeitschriften veröffentlicht, umfasste etwa anderthalb Zeitungsseiten und eine Zeichnung des IBA-Neubaugebietes.[9] Diese enthielt Ausschnitte von Tiergarten und Kreuzberg, rechts oben ein Stück Ost-Berlin, vom Rest getrennt durch eine eckige Punktlinie: die Mauer. Auf dem Plan waren schwarz die Konturen einiger neuer Straßen und Häuserblöcke eingezeichnet – das war der Bebauungsvorschlag. Darüber hinaus formulierte Kleihues sieben »Essentials«: Grundprinzipien, die die Stadterneuerung in diesem Gebiet bestimmen sollten. Darin brach er demonstrativ mit früheren Konzepten, die von Autobahnkreuzen quer durch Wohnviertel und von einem »City-Band« zwischen dem alten Zentrum (nun hinter der Mauer) und der »City-West« gesprochen hatten. Solche Tabula-rasa-Planungen des modernen Funktionalismus waren vorbei, und auch das Erbe des Architekten Hans Scharoun (1893–1972) galt nun als höchst ambivalent. Dessen von Solitären besetztes, leblos wirkendes Kulturforum erschien in seiner Randlage mittlerweile als ein städtebaulicher Albtraum, aus dem viele Stadtplaner vor und nach 1990 zu erwachen suchten.[10] Als Ziel verkündete die IBA »nicht Utopia, sondern die gebaute Stadt in ihrer lebendigen Vielfalt sozialer, funktionaler und räumlicher Beziehungen«.[11] Daher orientierte sich Kleihues, sofern das überhaupt noch ging, an historischen Straßenverläufen. Als eines der Essentials proklamierte er schlicht die »Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses der südlichen Friedrichstadt« – des einzigen Stückchens Altstadt, das diesseits der Mauer lag. Hier endete der West-Berliner Teil der Friedrichstraße im Mehringplatz, dem Betonkreis, der einst Berlins schönstes und offenstes Rondell gewesen war. »Der Zustand ist deprimierend«, stellte Kleihues fest, »eine Inkarnation brutaler Abbruch- und Planungspraxis, wie wir sie in vielen Städten unseres Landes seit dem Kriege zu beklagen haben. […] Was nicht völlig zerstört worden ist, fällt im Verlauf der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte einem nach heutigem Verständnis nicht mehr begreifbaren Abrißengagement zum Opfer.« Nun verlangte er »nach historischer und Zustands-Analyse als Grundlage für das, was neu entstehen soll und kann« – womit die folgenreiche Idee des Überlieferten als Bedingung des Kommenden Einzug in die West-Berliner Stadtplanung hielt.
Auffällig war weiter Kleihuesʼ unbefangener Umgang mit Gebieten direkt entlang der Mauer. Sein Rahmenplan umfasste unter anderem das Kulturforum, den ehemaligen Potsdamer Platz, das frühere Prinz-Albrecht-Gelände und die Quartiere südlich des Grenzübergangs Checkpoint Charlie. Auch für diese Grenzgebiete war Kleihues an den Zeichentisch gegangen. Damit traf er gewollt oder ungewollt Aussagen über die Qualität der Teilung Berlins, die er weitgehend als gegeben erachtete. Wo früher noch die Einheit der Stadt als oberstes Ziel galt und eigene West-Berliner Belange zweitrangig erschienen (weshalb etwa Scharouns Philharmonie nun abseits im Niemandsland stand), drehte die IBA die Prioritäten um. Kleihues orientierte sich 1981 »vorrangig an den Problemen West-Berlins«, wollte aber »die Hoffnung« nicht »ignorieren«, dass die Teilung der Stadt »einmal« überwunden werde. Lediglich in einem der sieben »Essentials« wurde diese Möglichkeit überhaupt konkret mitbedacht: Für Kleihues bot sich »– langfristig betrachtet – das sogenannte Spreebogengelände zwischen Reichstag und Kongreßhalle für die Einrichtung politischer, wissenschaftlicher und kultureller Institutionen nationaler oder internationaler Bedeutung an«. So verteidigte er halbherzig die deutsch-deutsche Flanke der IBA. Was gelesen werden konnte als eine Anerkennung des Wiedervereinigungsgebots, ließ durch die Worte »einmal«, »langfristig« und »international« allerdings zugleich viel Raum für andere Interpretationen.
Der Abschied von der Idee eines Zentrums im Wartestand wirkte befreiend. Kleihuesʼ Unterstützer priesen seine Versuche, dieses Stück Berlins, eine »große Stadtraum-Ruine«,[12] wo »alle Hauptstraßen zur Mauer führen und von ihr gekappt werden«, nun endlich anzupacken.[13] Die Orientierung am Überlieferten wurde dabei als das Ende der »Tabuisierung einer geschichtlichen Vergangenheit« gefeiert.[14] »Man hat genug vom Gigantismus«, schrieb ein Kritiker: »Die heutige Avantgarde will nicht zerstören, um neu beginnen zu können.«[15] Die Mauer sei dabei zwar ein schwieriges, aber nicht länger ein unüberwindbares Hindernis: »Die IBA kann und will der Stellungnahme zur Mauer nicht ausweichen. Die Dialektik, mit der sie zugleich akzeptiert und geleugnet wird, scheint die einzige Philosophie zu sein, die der augenblicklichen Lage gerecht wird.«[16] Dennoch blieb diese Lage prekär: »Freilich ist es schwer, gerade nahe der Schnittwunde zwischen den Stadthälften mit Entschiedenheit zu bauen.«[17]
Die letztgenannte Mutmaßung bestätigte sich in den folgenden Monaten und Jahren auf ungeahnte Weise. 1981 begann eine Zeit, in der die Mitte Berlins neu entdeckt und kodiert wurde. Dass dieser Raum vorerst weitgehend unbebaut blieb, war größtenteils ein Effekt der intensiven Suche nach Bedeutung. In Reaktion auf Kleihuesʼ Vorstoß und einige publizistische Debatten war der übergangene Berliner Senat an der Reihe. Es wehte gerade in diesem Sommer ein Hauch von Aufbruchstimmung durch das politische Berlin. Nicht nur war mit den Maiwahlen 1981 nach 33 Jahren die sozialdemokratische Vorherrschaft in West-Berlin zu Ende gegangen, sondern als drittstärkste Kraft war nunmehr die junge Alternative Liste ins Abgeordnetenhaus eingezogen, unter anderem dank einer prononcierten Stadterneuerungsagenda. Mit Richard von Weizsäcker (CDU) stand jetzt ein Regierender Bürgermeister an der Spitze, der als ähnlich charismatisch wahrgenommen wurde wie vor ihm Brandt oder Reuter. Obwohl es vorerst nur für einen CDU-Minderheitssenat reichte, wurde der Bruch deutlich empfunden.[18]
Weizsäcker hob aus der angeschlagenen Bauverwaltung ein kleines, aber ambitioniertes Ressort heraus: die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz. Geleitet wurde diese Behörde von dem jungen Juristen Volker Hassemer (CDU). Seine erste Aufgabe wurde die IBA, die durch die Abwahl des SPD-geführten Senats an Rückhalt verloren hatte. Hassemer musste im Sommer 1981 eine offizielle Stellungnahme zu dem demonstrativ an ihm vorbei präsentierten »Gesamtplan« abgeben. Im Herbst 1981 organisierte er daher eine Reihe von Veranstaltungen, die unter einem »Höchstmaß an Öffentlichkeit« stattfinden sollten. Darin wollte Hassemer »den Prozess der Kontroverse mittragen und aushalten«.[19] Das gelang unterwartet gut, denn in diesem »IBA-Expertenverfahren«, zu welchem er den kaum motivierten Kleihues mehr oder weniger zwang, bündelte sich 1981 das fragmentierte Stadtplanungs-Engagement – womit die Senatsverwaltung die Initiative zumindest zum Teil wieder zurückgewann.
Einerseits sollten im Rahmen des Expertenverfahrens sieben von Hassemer eingeladene internationale Fachleute Empfehlungen über die IBA-Pläne verfassen. Andererseits sollten zahlreiche Berliner Initiativen, Projekte und Gesprächskreise mitreden können, womit Hassemer die örtliche Expertise an sich band. Das Programm bestand aus einem fünftägigen »Hearing« im Oktober, einem zweitägigen vertiefenden »Symposion« im November und schließlich einer Präsentation der Empfehlungen auf einer »Anhörung« im Dezember 1981. Die meisten Veranstaltungen waren öffentlich. Sie füllten unter großem Medieninteresse beispielsweise den sonst leeren Reichstag.[20]
Die Experten wurden bei den ersten Treffen umfassend informiert. Die Gruppe wurde im Bus einen Tag lang durch West- und Ost-Berlin gefahren, letzteres allerdings ohne Kleihues, Hämer und Senator Hassemer, der in dieser Funktion nicht in Ost-Berlin auftreten konnte. Es folgten drei Tage mit Referaten vor allem von Berliner Spezialisten über das städtische Zentrum. Immer klarer erkennbar wurde in diesen Runden das Mitte-Rand-Paradox der Stadtviertel an der Mauer. Trotz des neuen Pragmatismus wuchsen beim konkreten Anfassen der Materie doch die Bedenken. Viele Diskussionen berührten das politische Selbstverständnis West-Berlins und das Verhältnis zum Osten. Die auswärtigen Experten wunderten sich darüber, dass solche Fragen für die Stadtplanung offenbar noch nie gestellt worden waren. Für sie hatte es den Anschein, als müsse die IBA »stellvertretend für die Bauverwaltung Aufgaben des Planungsamtes übernehmen«.[21] Zudem war es für den Expertenblick von außen schwierig, die Normalität der Inselstadt zu erfassen. Es wurden unaufhörlich Fragen nach der Beziehung zwischen beiden Stadthälften gestellt: »Kann über Entwicklungsziele diskutiert werden, ohne den Osten einzubeziehen?« »Oder ist Ost-Berlin wie ein ›weißer See‹ zu behandeln?« »Soll die Mauer beachtet werden, oder soll so gebaut werden, daß die Mauer nicht mehr sichtbar ist?«[22] Auch die Einengung des politischen Erwartungshorizontes durch die IBA nährte Zweifel: Über »eine Zukunft mit durchlässiger Mauer [wird] nichts ausgesagt, Ost-Berlin ist nicht existent«, stellte ein Beteiligter fest.[23] Ein anderer fand es schwierig, »vorauszusehen, ob das, was man heute zu tun sich vornimmt, zukünftige Entwicklungen nicht verbaut«.[24]
Im Dezember 1981 brachten die sieben Experten individuell ihre Gutachten zu Papier. Einige stellten fest, dass die IBA die Erwartungen deswegen nicht erfüllen könne, weil es an einer übergreifenden Idee für die gesamte »Insel« fehle. Dass diese neu zu formulieren war, stellte eine unerwartete Erkenntnis der IBA-Tätigkeit in Mauernähe dar. Damit wurde eine erste, im Grunde implizit schon immer geltende Kodierung des leeren Gebiets an der Mauer überraschend klar bestätigt: Hier, in der Mitte des alten Berlins und am Rande West-Berlins, musste die politische Identität der Gemeinschaft symbolisch sichtbar gemacht werden. Die Frage war jedoch: Welche Identität und welche Gemeinschaft? Gab es in West-Berlin überhaupt eine Aufgabe oder Funktion für dieses Brachgelände? Der Berliner Stadtplaner Edvard Jahn fasste das Dilemma in seinem Gutachten prägnant zusammen: Ost- und West-Berlin seien dabei, sich »zu zwei selbständigen Städten« zu entwickeln. Für den »Berührungs- bzw. Trennbereich« gebe es nun zwei alternative Denkwege: einer, der die »Teilung und notwendige Wiedervereinigung« auch für die Zukunft »sichtbar« erhalte und die unbebauten Flächen so belasse, und einer, der die Entwicklung West-Berlins »auch in diesem Bereich« vollende, den Platz also bebaue.[25] Diese Entscheidung war eine politische und wurde von den meisten Fachleuten an den Senat zurückgegeben.[26]
Im Februar 1982 legte Senator Hassemer, der inzwischen an Prestige gewonnen hatte, seine Schlussfolgerungen vor. Diese mögen in ihrer politischen Vorsicht manchen enttäuscht haben – immerhin ging es hier letztendlich um die Frage: »Muß die Teilung Berlins als Faktum hingenommen werden?«[27] Hassemer destillierte aus dem IBA-Verfahren ein Konzept, das ihm fortan in Auseinandersetzung mit Kleihues und Hämer wie auch bei einzelnen Bauprojekten als Leitfaden dienen sollte. Es war ein kurzes Papier voller für West-Berlin typischer Widersprüche und Paradoxien.[28] Ausgangspunkt war, dass sich in Berlin »aufgrund der politischen Teilung zwei Teilstädte entwickeln«, und dass jetzt, anno 1982, die Zeit reif sei, »klare Konturen« zu zeichnen. Als »leitende Idee« führte Hassemers Ressort einen eigenen Begriff ein, nämlich »die Neue Mitte Berlins«. Diese sollte von einem »Zentralraum« geprägt sein, der, so formulierte der Senator sorgfältig den Spagat, sowohl für West- wie auch für Gesamt-Berlin die Funktion einer »Mitte« erfüllen solle. Unter dem Eindruck der Mauer und ihrer demonstrativen Geschlossenheit versuchte der West-Berliner Senat hartnäckig das Terrain zu öffnen: »Bestimmendes Merkmal für diesen Raum ist deshalb seine Offenheit, einerseits im Sinn räumlicher Offenheit, zum anderen im Sinn der Offenheit für künftige Entwicklungen und Funktionen.« Das vergessene Randgebiet sollte künftig zum wichtigsten Stadtraum werden: »Hier stellt die Stadt sich dar, hier versammelt sie sich, von hier aus kann sie auch gesehen werden.«
Das Gebiet, das Hassemer meinte, lag im Spreebogen, am Reichstag und am ehemaligen Potsdamer Platz entlang der Mauer. Die Debatten um die IBA hatten die unerwartete Relevanz dieses Gebiets herausgestellt; es erhielt nun eine besondere Aufmerksamkeit und eigenständige Wirkung. Aus den Debatten hatte die Senatsverwaltung gelernt, dass die leere Mitte »der eigentliche Schlüssel« für ein neues »Stadtverständnis« sei.[29] Diese Mitte weiter zu gestalten nannte Hassemer 1982 »die größte Planungsaufgabe« seiner Zeit.[30]
Das galt aber nicht nur für die Senatsverwaltung. Nach dem »Expertenverfahren« spürte man an vielen Stellen Morgenluft, und überall wurde Bilanz gezogen. Bisherige Skeptiker waren beeindruckt von der Diskussionsfreudigkeit und dem hohen Niveau; sie sprachen nun »gewisse Hoffnungen« aus.[31] Fortan wurden Fragen der gebauten Stadt in unterschiedlichen Gruppen aufmerksam mitdiskutiert, von (halb)amtlichen Kreisen der Stadtverwaltung und der IBA selbst über Architektenvereine und Planungsstudenten bis hin zu Geschichtswerkstätten, ökologischen Aktivisten und Hausbesetzern. Die gebaute Stadt war im West-Berlin der 1980er-Jahre ein heißes Thema – und der Umgang mit dem »Zentralen Bereich« wurde bald ein Dauerbrenner.
2. Machtlose Visionen im
»Planungsverfahren Zentraler Bereich« (1982–1984)
Mit Blick auf diese »größte Planungsaufgabe« lud Hassemer Anfang 1982 etwa 30 örtliche Stadtplaner, Architektenbüros und Interessenvertreter zu einem »halböffentlichen« Diskussionsprozess über die »neue Mitte« ein.[32] Das auf die Dauer eines Jahres angelegte »Planungsverfahren Zentraler Bereich«, das von einer dreiköpfigen »Kerngruppe« koordiniert werden sollte, war in seiner Form neu und ambitioniert. Das konsultierende und prozessuale »Verfahren«, ein Schlagwort jener Jahre, erschien als »ein adäquater Typ von demokratischer Stadtplanung«[33] und als Alternative zum mehr geschlossenen und elitären »Ideenwettbewerb«. Abgesehen von der allgemeinen Krisenstimmung im West-Berliner Biotop, auf die man mit solchen demonstrativen Verfahrensexperimenten reagierte, zielten diese auch auf andere Größen. Es war allen klar, in welche Konkurrenzen und Traditionen sich die Teilstadt bei der Gestaltung des »Zentralen Bereichs« nun begab. Alles musste hier den Vergleich mit Hitlers Reichshauptstadt und auch den Vergleich mit Ost-Berlin bestehen, inhaltlich wie prozedural. Das war eine Chance und zugleich ein Minenfeld – es gab kaum eine Kritik, in der der Name Albert Speers nicht auftauchte.
Anders als zu früheren Zeiten verfügten die Berliner Stadtplaner diesmal jedoch nicht über ein Surplus, sondern über ein Defizit an Macht. Wie schon den IBA-Experten 1981 fehlte es den ehrenamtlichen Teilnehmern dieses Verfahrens an politischer Autorität, um Entscheidungen zu treffen. So entfaltete sich das gleiche Spiel ein zweites Mal: Händeringend warteten die Planer auf politische Grundsatzerklärungen hinsichtlich des Status und der Zukunft der Stadtteilung und damit auf eine machtvolle Aufhebung des Paradoxons von Anerkennung und Ablehnung der Mauer. Der Stadtplaner Hans Stimmann, damals Mitarbeiter an der Technischen Universität, gab zu bedenken, dass »die Existenz der Brachflächen, die zum ›Zentralen Bereich‹ werden sollen, ursächlich auf der inzwischen obsolet gewordenen politischen Prämisse (Wiedervereinigung) beruht«; daher müsse man sich »zuerst mit diesen politischen Vorgaben auseinandersetzen«.[34] Doch solche Vorgaben konnte die West-Berliner Senatsbehörde – selbst ein ziemlich widersprüchlicher Verwaltungskörper – kaum ohne Bonn formulieren, und die letzte Souveränität über West-Berlin lag auch in den 1980er-Jahren noch bei den Alliierten. Solche klaren Beschränkungen weckten auf Dauer Irritationen und untergruben bei den ehrgeizigen Planern den ohnehin schon ramponierten Ruf der Bauverwaltung. Einer von ihnen schrieb hämisch: »Und das ist eben die zentrale Schwierigkeit: sich den Verhältnissen zu stellen. Davor haben unsere regierenden Zwergbeamten Angst, davor laufen sie weg, seit der Krieg zu Ende ist. Bedeutung, Mitte, Zentrum, das alles ist da, mit Händen zu greifen, es will nur keiner.«[35]
Unter diesen Umständen war das Ideal einer breit getragenen, diskursiven Prozessplanung von kurzer Dauer und kein großer Erfolg. Zwar wurden in den wöchentlichen Gesprächsrunden, die sich zwischen Mai 1982 und Mai 1983 in wechselnder Zusammensetzung am Freitagnachmittag versammelten, alle denkbaren Aspekte des »Zentralen Bereichs« einer intensiven Inspektion unterworfen – Geschichte, Verkehr, Umwelt, Bebauung –, um die bisherige Vernachlässigung der Mitte zu kompensieren und möglichst viele Informationen zu gewinnen. Aber der Planungs- und Verfahrensoptimismus war nach einem Jahr des Redens und Tagens ohne Beschlussvollmacht größtenteils verflogen. Versuchen, die Ergebnisse zusammenzuführen und sich dabei zwischen den verschiedenen Planungsalternativen zu entscheiden, fehlten die Notwendigkeit und auch die Legitimation. Der fast 80-jährige Architekturkritiker Julius Posener, der Nestor der Berliner Architekturkritik, setzte lieber auf Zeit, Ruhe und Geduld, während jemand wie Dieter Hoffmann-Axthelm, der junge Kreuzberger Stadtplaner und Publizist, auf das Austragen von Kontroversen vertraute.[36] In den Sitzungen wurden viele Ideen skizziert, doch die Arbeit von Hassemers »Kerngruppe« blieb den West-Berliner Fachleuten ziemlich undurchsichtig. Persönlichkeiten wie Kleihues oder Wolf Jobst Siedler ließen sich nicht blicken, und das Interesse von Presse und Öffentlichkeit schwand rasch. Der Abschlussbericht der Kerngruppe wurde 1984 somit nicht der breit getragene »politische Entwurf«, auf den Hassemer ursprünglich gehofft hatte. Der Status des Berichts unterschied sich kaum von den vielen Papieren, die die Teilnehmer der Gespräche selbst eingebracht hatten. Ambitionierte Stadtplaner wie Hanno Klein, der bereits 1977 bei den »Strategien für Kreuzberg« ein vergleichbares Verfahren mitgestaltet hatte, und Hans Stimmann drängten deshalb darauf, diesen »Planungstyp« weiterzuentwickeln – ersterer wünschte noch mehr Diskussionsrunden und Offenheit, letzterer plädierte für eine tatkräftigere politische Lenkung.[37] Wenige Jahre später, nach dem Mauerfall, prägten beide in einflussreichen Positionen die Neugestaltung Berlins: Klein als Investorenbeauftragter[38] und Stimmann als Senatsbaudirektor (1991–1996 sowie 1999–2006).
Trotz der dünnen Ergebnisse trug diese zwei Jahre dauernde Spurensuche stark zur Kodierung und Deutung der Berliner Mitte bei. Amtssprachlich etablierte sich der Begriff »Zentraler Bereich«, und das Brachgelände an der Mauer war nun Gegenstand intensiver Wissensproduktion und Beobachtungspraktiken geworden. Je präziser man die leeren Flächen untersuchte, desto mehr »Geschichte« und verlorene Bedeutungen tauchten auf. Dabei wurden fast alle Probleme mit den erloschenen Idealen der Fortschrittsmoderne sowie mit Fragen der deutschen Nation, der Teilung der Stadt und auch der NS-Vergangenheit verbunden. Die vielen Unterlagen des Planungsverfahrens dokumentieren, wie die Blockade, hier zu bauen, durch mehr Wissen nicht geringer, sondern größer wurde. Die Gespräche starteten in einem optimistischen Geist, basierend auf dem neuartigen Konsens, dass West-Berlin mit dem Aneignen und Gestalten der eigenen »offenen Mitte« nicht länger auf eine Wiedervereinigung warten müsse. Das beflügelte die Kreativität. So begrüßte der Berliner Architekt Gerd Neumann das Planungsverfahren als Chance für »die Bewältigung des Halbstadtsyndroms, die Lösung von der lähmenden Fixierung auf Wiedervereinigung, die Abkehr vom Denken in Provisorien«. Denn die Situation West-Berlins dulde »auf Dauer kein Feld dieses Ausmaßes, das nur mit Hoffnungen besetzt ist – dem planerischen Wiedervereinigungspotential. Die Ermüdung solchen Hoffens entleert es vollends und läßt es zur terra incognita (zum erweiterten Todesstreifen) verfallen. Zwanzig Jahre nach dem Bau der Mauer ist es auch stadtplanerisch an der Zeit, sich mit den historischen Fakten zu arrangieren. Es wäre ein wohl verhängnisvoller Irrtum, auf unbestimmte Zeit einen unartikuliert offen-wunden Rand entlang der Trennungslinie als Bedingung der Wiedervereinbarkeit zu halten.«[39]
Derartige Statements, obwohl oft weniger radikal, bildeten den Ausgangspunkt für nahezu alle Beiträge am Planungsverfahren. Sogar der kritisch-konservative Architekturhistoriker und Verleger Wolf Jobst Siedler, der sich publizistisch regelmäßig in die Debatte einmischte, trug diesen Konsens mit: »Es kann seine Würde haben, sich der Wirklichkeit zu verweigern, aber wenn ein Zustand so lange währt wie die Dauer des Kaiserreichs, muß man sehen, daß man nicht in die Lage dessen kommt, der sich weigert, die Uhren aufzuziehen, um die Zeit anzuhalten. Nun macht niemand mehr einen Hehl daraus, daß die Stadt sich auf eine vorläufige Dauer einrichten muß. Das Provisorium, das sie ist, hält jetzt schon länger als Weimar und Drittes Reich zusammengenommen, und nichts spricht dafür, daß die heute lebenden Generationen eine Erfüllung der vergilbten Träume erleben werden.«[40]
So herrschte von links bis rechts unter West-Berliner Eliten Übereinstimmung, dass man sich des Zentrums jetzt annehmen müsse. Doch das Dilemma blieb: Wie sollte dies konkret geschehen? Hier schlugen alte Bedenken mit gewohnter Kraft zurück, und das Paradoxon vom Ablehnen und Akzeptieren der Mauer blieb unauflösbar. Gesucht wurde eine dauerhafte Lösung, in der eine künftige Veränderung doch irgendwie mitgedacht war. Neumann wollte die Mitte integrieren, um aus einer selbstständigen Inselstadt heraus neu auf Ost-Berlin zugehen zu können. Siedler hatte ein stolzes stadtpolitisches Zentrum für West-Berlin vor Augen, damit die politische Führung endlich aus dem provisorischen Rathaus Schöneberg ausziehen könne: »Und der Clou ist«, so fügte er listig hinzu, dass ein solches Zentrum im Spreebogen »zudem noch in solcher Lage zum historischen Stadtzentrum im anderen Teil der Stadt liegt, daß es bei einer Wendung der Dinge geradezu in das Zentrum der Stadt rücken würde, da man dem alten Berlin mit dem Schloß sein Herz genommen hat.«[41] So rangen sich die West-Berliner Eliten notgedrungen zu ihren eigenen Visionen und Zukunftsbildern durch. Diese entstanden zwar aus dem realpolitischen Abschied vom Wiedervereinigungsgebot, doch konnten sie es als Zukunftsvorstellung nicht völlig aufgeben. Auch Hassemers Kerngruppe formulierte eine solche »Arbeitshypothese«, eine Vision, die dem planerischen Gutachten Richtung und Legitimation gab: »Nachdem die zwei Teilstädte der Stadt Berlin sich über lange Zeit selbständig entwickeln, werden sie schließlich zu einer Doppelstadt wiedervereinigt. Auf dem Wege zu diesem Ziel wird sich schrittweise eine größere Offenheit zwischen den Teilstädten einstellen.«[42] Erst die Gegebenheiten akzeptieren, um dann doch irgendwie zusammenwachsen zu können – es klang wie das städtebauliche Äquivalent zum »Wandel durch Annäherung«.
Als ultimative Fernprognose galt Mitte der 1980er-Jahre das fließende Aneinander-Anschließen von Ost- und West-Berlin, getrennt und zugleich verbunden von einer »durchlässigen« Mauer. Ein entspannteres Grenzregime erschien hier als das mittelfristige Maximalziel, und als konkreter Wunschtraum wurde 1985 eine Situation anvisiert, in der die Grenzübergänge sich zu »Toren« verwandeln und an ihren historisch ›richtigen‹ Stellen liegen würden: »Der Mauerbau und die Sicherung der Mauer durch die DDR trennen die beiden Städte vollständig. Die Bürger müssen Tore passieren, wenn sie von der einen Stadt in die andere wollen. Die Tore liegen an den Orten, die primär aus sicherheits- oder ordnungspolitischen Gründen bestimmt wurden. Für die Stadt, für die Bürger, wäre es vernünftig, sie lägen an Orten, die historisch schon immer Tore waren. Auf diese Orte sind die großen Hauptverkehrsstraßen ausgerichtet. […] Ein erster Schritt der Annäherung und Normalisierung der beiden getrennten Teile sollte daher sein, die Haupttore der Teilstädte zu öffnen. Am Potsdamer Platz stünden sich dann auf der alten Reichsstraße 1 vorübergehend zwei derartige ›Tore‹ gegenüber [nämlich der Leipziger Platz und der Potsdamer Platz, K.T.]. Zwischen den Toren wäre ein freier, unbebauter Raum, der die ›Distanz‹ der Stadtkörper sichtbar macht und zur Organisation des geregelten Passierens der Tore genutzt werden kann. Er ist ein Raum im Übergang, eine moderne Form der alten Brache ›Vor den Toren‹.«[43]
Manche West-Berliner Planer waren sogar bereit, Räumlichkeiten für ostdeutsche Grenzkontrollen mitzudenken – doch solche Zukunftsbilder konnten ohne Abstimmung mit der »Hauptstadt der DDR« natürlich nicht realisiert werden. Die Kerngruppe empfahl daher vorläufig eine konträre Maßnahme, nämlich eine große Verkehrsstraße direkt entlang der Mauer, deren Verlauf somit bestätigend. Natürlich werde diese Straße aber »der Korrektur bedürfen, wenn die Tore nach Osten geöffnet werden können«.[44] (Ironischerweise wurde die Straße, die schon lange vor der Teilung existiert hatte, erst wieder angelegt, nachdem die Mauer gefallen war – die Ebertstraße.)
Auch die schlechten Erfahrungen mit gar nicht so alten, aber doch schon überholten Planungsvoraussetzungen der 1960er- und 1970er-Jahre erschwerten die Entscheidungen: »Es scheint unverzichtbar, anno 1982 Pläne ins Auge zu fassen, die weit ins nächste Jahrhundert reichen, auch wenn sie die bessere Einsicht dieser Zukunft nicht vorwegnehmen können.«[45] So entwickelte sich im Planverfahren ein eigentümliches Sprachregister widersprüchlicher Bezeichnungen: »vorläufige Dauer«, »gestaltete Provisorien« und »endgültige Zwischenlösungen«. (Der später so einflussreiche Hans Stimmann leistete sich 1980 gar einen peinlichen Fauxpas, als er schrieb, dass es im Berliner Zentrum nicht um eine »irgendwie geartete Endlösung« gehen könne.[46]) Daher schraubten die Gesprächsteilnehmer den anfänglichen Aktivismus bald wieder zurück. Nicht wenige ließen sich im Laufe des Planungsverfahrens davon überzeugen, dass man doch besser die Finger von der Berliner Mitte lassen sollte. Julius Posener war einer von ihnen: »Je länger ich mich mit den Planungen im Zentralen Bereich beschäftige, um so mehr überzeugt mich diese Gestaltlosigkeit.«[47] Und damit war West-Berlin zurück am Anfang, denn Formlosigkeit war ja bereits vorhanden.
So war die Ende 1984 gezogene Bilanz dürftig. Die Begeisterung war weg, der zum Kulturressort gewechselte Senator Volker Hassemer ebenfalls. (Er hatte allerdings weiterhin mit dem »Zentralen Bereich« zu tun, etwa im Rahmen der 750-Jahr-Feier 1987.) Seinem Nachfolger Horst Vetter (FDP) war der Umgang mit den diskussionsfreudigen Experten weniger vertraut. Er bestätigte 1985 bloß »die Aufgabe dieser Flächen als Reserveflächen für etwaige Hauptstadtfunktionen«. Dabei dementierte er, dass dies »eine Abkehr von der politischen und planerischen Zielvorstellung einer Wiedervereinigung« bedeute, »so fern diese Zukunft auch liegen mag«.[48] Die Kerngruppe hatte derweil »die Vorstellung aufgegeben, das Reichstagsviertel könnte einmal Sitz einer neuen deutschen Regierung sein«. Sie fand aber eine ganz elegante, unpolitische Ausrede dafür: »Die Flächen des Viertels wären zu klein, den notwendigen Raum zu bieten. Bebauungen weit über das Viertel hinaus wären erforderlich. Der bedeutsame Ort der Stadt würde untergehen. Eine neue Stadt würde entstehen. Dafür fehlen hier die Vorstellungen.«[49]
Die Formulierung verdeutlicht eine weitere symbolische Aufladung des leeren Spreebogens einige Jahre vor der plötzlichen Vereinigung beider Stadthälften: West-Berlin hatte Mitte der 1980er-Jahre zwar durch eine kulturelle Introspektion sehr viel an Wissen und Engagement gewonnen, aber das hatte die Hürde, dieses Gebiet durch Bebauung systematisch zu erschließen und anzueignen, nicht kleiner gemacht. Im Gegenteil: Der »Zentrale Bereich« war zwischen 1981 und 1985 vom verwahrlosten Stadtrand zu einem politisch äußerst sensiblen Gebiet geworden, wo unter den Umständen der Teilung fast nur Fehler gemacht werden konnten. Das richtete die Fläche mit noch größerer Kraft auf die als Utopie empfundene »Wendung der Dinge« (Siedler) aus. Hier spukten nunmehr für jeden spürbar die Geister der nationalen Geschichte, und die Frage war, wie man ihnen entgegentreten sollte. Nichts verdeutlicht die symbolüberladene Ratlosigkeit hübscher als die Verlegenheitslösung, die einer der Architekten im Planungsverfahren als neue Bezeichnung für den leeren Spreebogen vorschlug: »Zur Deutschen Aussicht«.[50]
(Landesarchiv Berlin, Kasperski, Edmund, F Rep 290 [02], Nr. 0277122)
(Landesarchiv Berlin, Siegmann, Horst, F Rep 290 [02], Nr. 0274460)
3. Ein Park für die deutsche Geschichte
Bei aller Unentschiedenheit waren sich die Beteiligten in diesen Jahren über eines aber ganz sicher geworden: Im »Zentralen Bereich« sollte ab sofort nichts mehr abgerissen werden. Die (wenigen) historischen Überreste begannen handlungsleitend zu werden. »Nur zerstören – etwa durch eine durchgehende Wohnbebauung – sollte man die großen Einschnitte nicht«, meinte Posener Ende 1982. »Hierüber sind sich offenbar alle […] mit dem Zentralen Bereich beschäftigten Planergruppen einig.«[51] Stimmann stellte Ende 1983 zufrieden fest, dass nunmehr »vorhandene stadträumliche und topographische Gegebenheiten als ›harte‹ Planungsvoraussetzung gesehen werden«.[52]
Hier nahm die Karriere der geschichtlichen »Spuren« ihren Anfang, die in West-Berlin (und nicht nur dort) parallel auch in der »neuen Geschichtsbewegung« eine zentrale Bedeutung gewann.[53] Schon die frühesten IBA-Runden zur »Rettung der kaputten Stadt« hatten sich das Aufdecken verschütteter Geschichte zur Aufgabe gemacht: »Wir wollen Erinnerungen und Spuren wahrnehmen!«[54] Wenn Planer über den »Organismus der gewachsenen Stadt« schrieben oder über die »Rückkehr zum historischen Stadtgrundriss«, dann waren die Rückorientierung auf das Frühere und vor allem die Abgrenzung von der jüngsten Vergangenheit allerdings oft diffus (und darin lag auch das politische Integrationspotential): Waren die Zeit und die Verbrechen des Nationalsozialismus als Negativbezug gemeint? Oder die Bomben des Zweiten Weltkriegs und ihre Folgen? Ging es um die Spaltung der Stadt und die Herrschaft des Sozialismus, mitsamt der Mauer? War die rücksichtslose Stadtplanung der 1960er-Jahre die Kontrastfolie? Oder alle utopischen Entwürfe für Berlin überhaupt?
(Foto: Jürgen Henschel; FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum)
Das Ziel dieses städtebaulichen Diskurses war es jedenfalls nicht, Berlin von der Last der NS-Vergangenheit zu befreien. Im Gegenteil, der neue Geschichtsboom lebte in weiten Teilen auch von deren Entdeckung – nicht zufällig parallel mit einer Serie 50. Jahrestage seit dem 30. Januar 1983. Viele Akteure, allen voran die zivilgesellschaftlichen Initiativen, forderten, dass gerade die »Spuren« der früheren NS-Reichshauptstadt im Stadtraum dokumentiert und eingeschrieben werden sollten; manche wollten die bleibenden »Wunden« sogar als eine Art Leitfaden für die Neugestaltung West-Berlins nehmen. Deswegen war etwa die Situation am Kulturforum so sperrig, denn hier erkannte man ganz prominent nicht nur die Handschrift Scharouns, sondern auch diejenige Speers, dessen Tod im September 1981 die Berliner Diskussionen weiter stimulierte.[55] Von Anfang an war auch die Debatte um das frühere Prinz-Albrecht-Gelände, wo sich in der NS-Zeit das Hauptquartier von SS, Sicherheitsdienst und Gestapo befunden hatte, eine Verdichtung dieses neuen Diskurses. Hier wurde vielleicht zum ersten Mal anschaulich, wie sehr bestimmte historische Ereignisse und Nutzungen einen »Ort« konstituieren, ihn in den Griff nehmen und damit die Stadtplanung der Gegenwart dominieren können.[56] Das historisch belastete Gelände schien sich gegen jede Form von Neubeginn zu wehren, und die Sprache, die diesen Eindruck nährte, ist auch bei Architekten nachweisbar. Schon 1981 schrieb Kleihues: »Die Asphaltierung des Geländes, von dem aus die schlimmsten Greueltaten des Nationalsozialismus gelenkt worden sind, hätte als symbolische Asphaltierung des Gewissens provoziert und verletzt.«[57]
So begann mit der Entdeckung und Deutung des »Zentralen Bereichs« eine Denkweise, die die Stadt Berlin als »Chronotop« versteht, als einen Ort, an dem Zeit und Raum verschmelzen.[58] Diese neuen Begriffe und Projektionen – die sich noch nicht auf den ein Jahrzehnt später einsetzenden kulturwissenschaftlichen Gedächtnisdiskurs stützen konnten, sondern ihm vorausgingen – kündigten sich in den frühen 1980er-Jahren unmissverständlich an. Sie wurden, da politisch noch nicht dominant, vorerst als Gegenerzählungen artikuliert – zum Beispiel im Laufe des Planungsverfahrens.
Hier schlug die Stunde des bereits erwähnten Kreuzberger Planungskritikers Dieter Hoffmann-Axthelm, studierter Historiker und Theologe, der einer der wortgewandtesten Propheten dieser Umdeutung des Stadtraums wurde. Hoffmann-Axthelm war Mitgründer der Zeitschrift »Ästhetik & Kommunikation« (seit 1970), galt als einer der Protagonisten bei der Erschließung des einstigen Gestapo-Geländes und stieg während der IBA-Hearings zum Starkritiker empor. Sein furioser Essay zum »Berliner Zentrum« (1981) wurde einer der frühen Leittexte zur Neu-Verbindung von Geschichte und Stadtraum: »In den Löchern von Berlin, an die bisher weder Bagger noch Kommerz so recht herankamen, hockt die deutsche Geschichte, das zerstörte Metropolengefühl.«[59] Hoffmann-Axthelm fürchtete die damaligen Versuche, das Berliner Zentrum zu erschließen; er sah »diese Mitte in Gefahr, und vermutlich wird es sie bald nicht mehr geben. Das sicherste Anzeichen dafür ist, daß Stadtplanung und Architekten sich dieser Mitte bemächtigen.« Aber: »Die reuige Rückwendung zur alten Berliner Stadtmitte ist nicht mehr möglich. Ihre Zerstörung ist das sinnvolle und logische Ergebnis der preußisch-deutschen Geschichte. Dieses zentrale Territorium ist buchstäblich zerstört, nivelliert, entleert. Es ist kein Ort mehr. […] Zwischen Wilhelmstraße und Potsdamer Straße […] hört die Geschichte auf, stadtfähig zu sein. Hier, wo das Schlimmste geschah, im Reichssicherheitshauptamt, in der Reichskanzlei und ihren Bunkern, hier hat die wirkliche Stadt, die gescheiterte, zerstörte Metropole, ihre letzte Zuflucht. Die Ruinen sind weg, aber nicht die Grundrisse, die Straßenverläufe, die ehemals staatlich besetzten Flächen mit ihren berüchtigten Namen. Wenn irgendwo, ist hier die Mitte Berlins. Diese Mitte ist negativ, aber sie ist eine. Man kann sich das nicht aussuchen. […] Was wir eigentlich brauchen, wäre ein Wiederaufbau, der die Tatsache der Zerstörung festhält und aus dem Wiederhergestellten nicht wieder eine naive Kulturveranstaltung macht, unschuldig und ohne Harm.« Damit kündigte sich eine stadträumliche Metareflexion an, die nicht nur die vergangene Geschichte demonstrativ zu markieren sucht, sondern auch den Umgang damit.
Im Sog der Introspektion, die sich West-Berlin ab 1980 geleistet hatte, entstanden neue Semantiken mit eigener Rationalität und neue fachdisziplinäre Formationen. Dazu gehörte an zentraler Stelle die innovative Zusammenarbeit zwischen Historikern und Architekten. Von der Genese, den Überraschungen und den Problemen dieser ungewohnten Kooperation zeugt das Gutachten über den »Zentralen Bereich«, das der Senat 1981 in Auftrag gegeben hatte und das 1984 in einem Doppelband publiziert wurde.[60] Ausgeführt wurde der Auftrag von der Architekturwerkstatt Pitz/Brenne und dem Historiker Wolfgang Hofmann; sie konnten sich bereits auf eine längere Tradition von Werkstattgesprächen zum Berliner Zentrum stützen. Die jetzige Aufgabe, so erklärte das Vorwort, »verlangte von zwei recht unterschiedlichen Disziplinen (Historikern und Architekten) zunächst einmal die Findung einer möglichst gemeinsamen ›Sprache‹«. Das Gutachten hatte zum Ziel, »den geschichtlichen Bedeutungsgehalt« des »Zentralen Bereichs West« (benannt nach einem ehemaligen Postbezirk) kenntlich zu machen, und zwar »im Gesamtzusammenhang der deutschen und Berliner Geschichte«.[61] Aber das Verzeichnen ›der‹ Geschichte im Berliner Zentrum war auf eine kaum zu bewältigende »Materialschlacht« hinausgelaufen.[62] Nach wiederholten Kürzungen zählte die zweibändige Arbeit immer noch mehr als 850 Seiten. Einerseits war das Gebiet, um das es ging, ziemlich groß, und es gab nur wenige systematische Vorarbeiten. Andererseits war die Flut von Informationen aber auch eine Folge des neuen Blicks: Geschichte war plötzlich überall.
Das Gutachten informierte en détail über frühere Stadtplanungen und Projekte, realisierte wie auch nur entworfene, und über die politische Geschichte des »Zentralen Bereichs«. Ausgestattet mit vielen Karten, Fotos und Skizzen präsentierte es eine lange Reihe »historischer« Stätten und Bauten. Aus der Arbeit spricht ein enzyklopädischer Hunger nach Geschichte, nach Wissen und Dokumentation, und vor allem nach Spuren von vergessenen oder verdrängten Ereignissen. Insbesondere die Passagen über das »Dritte Reich« zeugen von Spannung und Aufklärungsdrang, wobei der heutzutage fast selbstverständliche Fokus auf den »Holocaust« hier begrifflich und thematisch noch fehlt. In den frühen 1980er-Jahren waren Historiker und Architekten gerade erst dabei, Speers »Germania«-Planungen genauer zu rekonstruieren und durch Dokumentation zu entmythologisieren.[63] Ansonsten konzentrierte sich die Übersicht zur NS-Zeit auf die »Machtergreifung«, den Widerstand im Umfeld des 20. Juli 1944 und die sowjetische Eroberung Berlins – Ereignisse, die ihre Spuren im »Zentralen Bereich« sehr nachdrücklich hinterlassen hatten. Die Tätergeschichte des vormaligen Prinz-Albrecht-Geländes war in diese frühe Erzählung zwar noch nicht so recht eingedrungen, doch die Autoren des Gutachtens plädierten kräftig für seine künftige Erschließung.
Die Gruppe aus Stadtplanern und Historikern empfahl Berlin einstimmig das Dokumentieren von Geschichte, »im Sinne einer Bewahrung und Neugestaltung für die aktuellen Bedürfnisse unserer und zukünftiger Gegenwart«.[64] Vom Hamburger Bahnhof über den ehemaligen Königsplatz am Reichstag, den Tiergarten, den Kemperplatz, die Potsdamer Straße und den Anhalter Bahnhof bis hin zum früheren Prinz-Albrecht-Gelände setzten die Empfehlungen auf ein »Sichtbarmachen« und »Wiederaufnehmen«. Die »vergessenen« Orte wurden zum neuen Topos. Die Bedeutung diverser »Orte« wurde nun von Aktivisten, Historikern, Stadtplanern, Architekten und Bürgerbewegten unterstrichen, die Orte selbst zurück »ins Bewußtsein« gebracht, mit Wissen erschlossen (im Unterschied zur späteren, oft mehr pathetischen als wissensbasierten Rede von den »Erinnerungsorten«). »Die keineswegs zufällige Konzentration von historischen Stätten (Reichstag, Bendlerblock, Kroll-Oper, Volksgerichtshof, Gefängnisse, Prinz-Albrecht-Komplex, Lichtensteinbrücke) bietet […] die Möglichkeit, den historischen Ablauf von Ereignissen nicht nur an Fotos, sondern an den originalen historischen Orten differenzierter zu verdeutlichen und auch räumlich verstehbar zu machen.«[65] In der Tat war diese Suche besonders ertragreich, denn bei genauerer Betrachtung wimmelte es im scheinbar leeren Berlin von »Orten« und »Stätten«, wo sich Historisches zugetragen hatte. Das Gutachten wollte sie für den »Zentralen Bereich« am liebsten alle dokumentieren.
Dabei setzte sich bald ein weiteres Attribut der neuen historischen »Stätten« durch: Für ihre Bedeutung spielte es keine primäre Rolle, ob und inwiefern am Ort selbst noch originale Bausubstanz oder zumindest Überreste vorhanden waren. Abwesenheit von Spuren – ein häufiges Phänomen im »kaputten« Berlin – war höchstens ein Hindernis sekundärer Art, denn der Ort als solcher könne sich auch unabhängig von seiner Materialität enthüllen. Innerhalb dieses Denkrahmens war es nur konsequent, dass die Autoren des Gutachtens auch Pläne aufnahmen von Stätten, die eigentlich verschwunden waren. Vielerorts waren »nur noch geringe Restelemente der früheren Strukturen« sichtbar, und viele Teile des Stadtraums mit Bedeutung für die Revolutionen von 1848 oder 1918 oder für die Geschichte des Nationalsozialismus waren überhaupt »nur noch schwer zu identifizieren«.
In der Tat, die Geschichte war aus der Gegenwart verschwunden – die emphatische Betonung der »Spuren« (und das Graben nach ihnen) konnte daran wenig ändern. Die Lösung, die West-Berliner Stadtentwickler in den 1980er-Jahren wählten, war das Anbringen nachträglicher Markierungen im städtischen Raum. Das sollte dazu dienen, »diese historischen Orte nicht zu ›Freiräumen‹ ohne Beziehung zu ihrer Vergangenheit werden zu lassen«, sondern die Zeit in der Stadt zu fixieren. Die Markierung konnte auf viele verschiedene Arten geschehen: mit Wegweisern und Schildern, mit einer Wanderroute entlang der Mauer, ausgestattet mit einer »optischen Leitlinie« entlang der »historischen Stätten«. Auf diese Weise, so die Autoren, könne der »Zentrale Bereich« eine Art »Park für deutsche Geschichte« werden.
In Anbetracht der beiden Leitdisziplinen Architektur und Geschichte ist es gewiss kein Zufall, dass die neue Sprache in der Bildung räumlicher Metaphern für das Historische glänzte – auch das ein folgenreicher Schritt in der Kodierung eines »neuen« Berlins. Schon 1981 wurde in diesem Zusammenhang der Begriff »Geschichtslandschaft« geprägt,[66] die dutzende reale und imaginäre, vorhandene wie verschwundene »historische Erinnerungsstätten« bündelte und auf die domestizierte, umzäunte Vision eines »Geschichtsparks« hinauslief.[67] Die Protagonisten betrieben nach eigener Einschätzung »eine moderne Form von Stadtarchäologie«.[68] Das Planungsverfahren wies den »Zentralen Bereich« aus als einen »Torraum, der Erinnerungen wach hält«,[69] und die Autoren tauften die hier »vorhandenen Brachen und Räume« deshalb »Erinnerungsräume«.[70] Bei allem Streit über die konkreten Maßnahmen gab es weitreichenden Konsens über das Ziel: »Zunächst nur sicherstellen, daß der Ort erhalten bleibt.«[71]
Die Umkodierung der randständigen, vernachlässigten Brachen an der Mauer zu Orten mit historischer Bedeutung war Mitte der 1980er-Jahre mehr oder weniger vollendet. Ende 1985, als der Senat mit der Ausschreibung für die Gestaltung des Platzes der Republik vor dem Reichstag einen neuen administrativen Vorstoß unternahm, präsentierte er das Gebiet bereits als »eine zentrale Anlauffläche für Berlin-Besucher«, denn hier sei »die ältere und jüngere Geschichte Berlins im Besonderen erfahrbar«. Diese Aussage wäre noch wenige Jahre zuvor aus dem Munde von West-Berliner Senatoren undenkbar gewesen. Sie mobilisierte die Geschichte und deren Brüche explizit als Ressource für das Stadtmarketing. Das Gebiet galt nun »trotz seines zum Teil desolaten Erscheinungsbildes« als attraktiv, denn 1985 war es gerade das unkoordinierte Chaos, das die suggestive Präsenz früherer Zeiten unterstrich.[72]
Zu baulicher Gestaltung führten die geschilderten Erkenntnisse vorerst nicht, im Gegenteil. Je mehr Geschichte in den »Zentralen Bereich« hineingetragen wurde, desto sakraler und unberührbarer wurde der vorhandene Stadtraum. »Das Aufzeigen dieses Spektrums an historischer Präsenz macht […] deutlich meßbar und diskutierbar«, schrieb Senator Vetter Ende 1984 ahnungsvoll, »wie empfindsam der Zentrale Bereich auf gestalterische Veränderungen reagieren wird«.[73] Wo soeben noch Leere gewesen war, standen die Verantwortlichen nach einer Reihe von Gesprächen, Expertisen und Visitationen vor einem hemmenden Überschuss an Symbolik. Schon 1981 protokollierte einer der Beteiligten, dass »alle diese Gebiete hier dermaßen mit historischer Bedeutung belastet und geradezu überdeterminiert sind, daß kein ernsthafter Gestaltungsversuch davon absehen könnte«.[74] Neben dem traditionellen Vorbehalt einer künftigen Wiedervereinigung war die neue Mitte an der Mauer nun zusätzlich mit einem historischen Vorbehalt versehen worden.
Unumstritten war das nicht, und stets wurde diese Entwicklung des stadträumlichen Geschichtsdiskurses von Kritik und Warnungen begleitet: Als Antwort auf die Frage, wie »gegen Ende dieses Jahrhunderts eine europäische Großstadt nach den Verwüstungen des Krieges und der Nachkriegsplanung sich selbst neu definiert«, reiche »der Rückgriff auf den historischen Stadtgrundriß […] nicht aus«, so ein Kritiker 1982.Ärgerlich erschienen ihm »das akademische Kleben an der Vergangenheit und die kleinliche, zum Teil kleingeistige Besessenheit durch das Vorhandene«.[75] Auch andere Akteure zeigten sich skeptisch hinsichtlich dieser »Zeit der Nostalgie und historisierender Anwandlungen« und wehrten sich gegen einen »Zeitgeist, der wegen der unsicheren Zukunft Zuflucht in Ordnungsprinzipien der Vergangenheit sucht«.[76] Die historischen Strukturen und die ganzen Bezüge seien »längst zerbrochen, sie sind nur noch Erinnerung«.[77] Solche Kritik gipfelte in dem Vorwurf, dass etwa die Pläne der IBA »kaum einen Beitrag zur Zukunftsbewältigung Berlins« leisteten.[78]
Diese letzte Behauptung wurde in paradoxer Weise von der Geschichte widerlegt. Denn ganz anders als noch in den 1980er-Jahren denkbar, halfen die West-Berliner Konzepte von »Kritischer Rekonstruktion«, »historischen Stätten« und »neuer, offener Mitte« bei der Handlungsorientierung nach dem plötzlichen Mauerfall – gerade auch in Ost-Berlin, das selbst zwar eigene Debatten zur historischen Stadtstruktur in die neue Bundeshauptstadt mit einbrachte, doch seit 1990 von West-Berliner Stadtplanern völlig überflügelt wurde.[79] Die 1981 zunächst noch tastende Suche nach Geschichte und Identität im Stadtbild trug auf diese Weise völlig unvermutet »zur Zukunftsbewältigung« bei: Ihre Leitbilder inspirierten so verschiedene und kontroverse, aber prägende Vorstellungen wie Hans Stimmanns »historische« Bauvorgaben für die Friedrichstadt (Traufhöhe), die mit Monumenten beladene »Geschichtsmeile« um den Reichstag und den Potsdamer Platz oder auch Dieter Hoffmann-Axthelms »Planwerk Innenstadt« für das Ost-Berliner Zentrum. Stets übertrugen Diskussionsteilnehmer aus den 1980er-Jahren nun ihre Vorstellungen auf die andere Hälfte der Stadt.[80]
All das war völlig unvorstellbar, als West-Berlin sich in den frühen 1980er-Jahren neu zu interpretieren begann. Zu einem tragfähigen und zusammenhängenden Konzept für den »Zentralen Bereich« brachte es die westliche Halbstadt nicht mehr, und bis 1989 drangen lediglich vereinzelte Projekte am Kulturforum, am Kemperplatz (Hotel Esplanade) oder am ehemaligen Gestapo-Gelände »behutsam« in die leere Mitte vor. Diese wurde jedoch verstärkt kulturell kodiert und mit temporalen Begriffen von Geschichte und politischer Vorläufigkeit beschrieben. Davon zeugten auch 1987 die Veranstaltungen des 750-jährigen Stadtjubiläums, das West-Berlin weitgehend in eben diesem »Zentralen Bereich« ausrichtete, unter der topographisch wie politisch gemeinten Formel »Vor den Toren der Stadt«.[81] Die Vorbereitung des Jubiläums hatte die Sensibilität für historische Bausubstanz weiter erhöht. Die IBA war bis 1987 verlängert worden; nun wurden viele Gebäude renoviert und mit Ausstellungen neu bespielt, etwa der Hamburger Bahnhof am Grenzübergang Invalidenstraße oder der Martin-Gropius-Bau an der Mauer. Auch für den Reichstag selbst, 1987 eine prominente Bühne für Popkonzerte und vage Zukunftsspiele, gab es neue Renovierungsvorschläge, Verhüllungspläne und eine erste Kuppeldiskussion.
(Landesarchiv Berlin, Kasperski, Edmund, F Rep 290 [02], Nr. 0290294)
Vor allem aber wurde das Jubiläum ein Fest der verschwundenen Geschichte und der Provisorien. Hoch über die Sandwüste entlang der Mauer führte die Probestrecke der Magnetbahn zur Philharmonie, ihrerseits für die 750-Jahr-Feier erweitert um Hans Scharouns Kammermusiksaal. In den Kinos lief Wim Wendersʼ Film »Der Himmel über Berlin«, eine Hommage an den verschwundenen Potsdamer Platz. Am Großen Stern war eine riesige Freilichtbühne aufgebaut worden, die die Siegessäule als gebrochene Projektionsfläche eines historischen Multimediaspiels nutzte, und hinter der Ruinenfassade des Anhalter Bahnhofs gab es unter Zeltdächern das umstrittene Kunstprojekt »Mythos Berlin« zu besichtigen, das am windigen Bahngelände die verlorene Metropole imaginierte. Am früheren Gestapo-Gelände hatten 1986 unter Druck von Bürgerinitiativen und aus Anlass des nahenden Jubiläums professionelle Grabungen stattgefunden, die unerwartete Reste von Gefängniszellen zu Tage förderten. Rasch wurden diese neuen »Spuren« konserviert, dokumentiert und in einem zurückhaltenden Ausstellungsgebäude – als Provisorium – erstmals einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Das Berliner Zentrum wurde 1987 zu einer Art Open-Air-Museum, die »Erinnerungslandschaft« lebte und wuchs.
Mittendrin, gegenüber dem Reichstag, enthüllte Bundeskanzler Helmut Kohl unter pfeifenden Protesten linker Demonstranten im Oktober 1987 den Grundstein für ein Deutsches Historisches Museum (DHM), sein Geburtstagsgeschenk für die Inselstadt. Das seit 1983 diskutierte Regierungsvorhaben war in West-Berlin auf nur verhaltene Gegenliebe gestoßen. Angeführt vom nunmehrigen Kultursenator Hassemer (einem Parteifreund Kohls) wollte die städtische Kulturszene den wiederhergestellten Martin-Gropius-Bau, den Ort der Preußen-Ausstellung von 1981, dafür nicht hergeben.[82] Dass der Kanzler daraufhin den leeren Spreebogen als prädestinierten Ort für ein Geschichtsmuseum erkannte, stand durchaus im Einklang mit der Umdeutung des »Zentralen Bereichs« zum Identitätsgelände, wo die historische Zeit fassbar erschien. Allerdings störte die staatsrepräsentative Aufladung, zumal unter konservativen Vorzeichen und aus dem fernen Bonn, viele West-Berliner Diskutanten erheblich. Die Entscheidung für ein Museum am Ort der früheren Kroll-Oper sprengte den länger vorbereiteten und 1985 angelaufenen Wettbewerb zum Platz der Republik im Spreebogen. Nach bereits erfolgter Ausschreibung gab es Modifikationen im Auslobungstext, dann Ärger in der Jury und am Ende keinen Wettbewerbssieger, sondern drei zweite Preise. So war 1986 auch dieser Anlauf zu einer Neuordnung im »Zentralen Bereich« gescheitert.[83]
(Landesarchiv Berlin, Kasperski, Edmund, F Rep 290 [02], Nr. 0291362)
Der Grundstein des DHM bezeugte, wie sehr die vernachlässigten Brachen Berlins bereits in den 1980er-Jahren zur imaginären neuen Mitte geworden waren. Hier wurden verloren geglaubte Güter wie Nation und Geschichte gesammelt und erfahrbar gemacht. Diesen Prozess durch Bauentscheidungen abzuschließen war jedoch nahezu unmöglich geworden – gerade wegen der neuen symbolischen Aufladung.[84] Der Zustand harrte der Auflösung des Widerspruches, bis das fast Undenkbare plötzlich geschah: die Öffnung der Mauer und in der Folge die Entscheidung für Gesamt-Berlin als neue Bundeshauptstadt. Allen Beteiligten war klar, was in der Mitte der Stadt nun zu schaffen war: ein neues Regierungszentrum und eine neue Version des legendären Potsdamer Platzes. Trotz der tiefgreifenden politischen Veränderung und internationalen Öffnung kamen die Rahmenvorstellungen für ein »neues Berlin« aus den West-Berliner Schubladen.
Anmerkungen:
[1] Winfried Rott, Die Insel. Eine Geschichte West-Berlins 1948–1990, München 2009. Ich danke der Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) für eine Projektförderung, die die Arbeit am vorliegenden Aufsatz ermöglicht hat.
[2] Stefanie Eisenhuth, West-Berlin und der Umbruch in der DDR. Grenzübergreifende Wahrnehmungen und Verhandlungen 1989, Berlin 2012; Krijn Thijs, Entfernter Erfahrungsraum. Überlegungen zu West-Berlin und 1989, in: Eurostudia. Revue transatlantique de recherche sur l’Europe 7 (2011) H. 1-2, S. 29-45; Wolfgang Müller, Subkultur Westberlin 1979–1989, Hamburg 2013.
[3] Vgl. Rott, Die Insel (Anm. 1), S. 338ff.
[4] Harald Bodenschatz/Vittorio Magnago Lampugnani/Wolfgang Sonne (Hg.), 25 Jahre Internationale Bauausstellung Berlin 1987. Ein Wendepunkt des europäischen Städtebaus, Berlin 2012; Harald Bodenschatz u.a., Learning from IBA – die IBA 1987 in Berlin, Berlin 2010; Günter Schlusche, Die Internationale Bauausstellung. Eine Bilanz, Berlin 1997.
[5] Josef Paul Kleihues, Die Rekonstruktion der zerstörten Stadt, in: Rainer Nitsche (Hg.), Leitfaden. Projekte, Daten, Geschichte. Internationale Bauausstellung Berlin 1987, Berlin 1984, S. 37f. Die »Kritische Rekonstruktion« wurde zum Leitbild vieler städtebaulicher Maßnahmen im vereinten Berlin der 1990er-Jahre. Skeptikern zufolge wurde dabei die »kritische« Komponente immer weiter zurückgedrängt – zugunsten der rekonstruierenden, historisierenden, teils gar nostalgischen Ansätze. Zur sich verändernden politischen Bedeutung des Begriffs: Florian Hertweck, Der Berliner Architekturstreit. Architektur, Stadtbau, Geschichte und Identität in der Berliner Republik 1989–1999, Berlin 2010, S. 45-63.
[6] Hardt-Waltherr Hämer, Für einen liebevolleren Umgang mit der Stadt, in: Nitsche, Leitfaden (Anm. 5), S. 35f.; Bodenschatz u.a., Learning from IBA (Anm. 4), S. 18.
[7] »Spaltung in arm und reich«. West-Berlins »Internationale Bauausstellung 1984« vor der Pleite, in: Spiegel, 7.9.1981, S. 208-214; Schöne Zeit, in: Spiegel, 21.9.1981, S. 252f. Unterstützung für Kleihues kam von Manfred Sack, Wenn Kreuzberg kippt, brennt Berlin, in: ZEIT, 4.9.1981, S. 43.
[8] Tilman Buddensieg, Ein neues Gesicht für Berlin, in: ZEIT, 24.7.1981, S. 33f. Vgl. Schlusche, Die Internationale Bauausstellung (Anm. 4), S. 107ff.
[9] Josef Paul Kleihues, IBA – Die Internationale Bauausstellung Berlin, in: Tagesspiegel, 22.8.1981, S. 12.
[10] Helmut Geisert/Eckhart Gillen (Hg.), Platz und Monument. Die Kontroverse um das Kulturforum Berlin 1980–1992, Berlin 1992.
[11] Kleihues, IBA (Anm. 9); dort auch die folgenden Zitate.
[12] Buddensieg, Ein neues Gesicht (Anm. 8).
[13] Wolfgang Braunfels, Der dritte Weg, in: Tagesspiegel, 5.9.1981, S. 11.
[14] Buddensieg, Ein neues Gesicht (Anm. 8).
[15] Wolfgang Braunfels, Internationale Bauausstellung zwischen Weltweite und Stadtenge, in: Tagesspiegel, 13.9.1981, S. 34.
[16] Ders., Politik und Architektur, in: Tagesspiegel, 20.9.1981, S. 34.
[17] Ders., Der dritte Weg (Anm. 13).
[18] Rott, Insel (Anm. 1), S. 354.
[19] Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hg.), Werkstattbericht zum Hearing vom 10. bis 14. Oktober 1981 – Expertenverfahren zum IBA-Plan für die Neubaugebiete, Berlin 1981, S. 7-10, hier S. 7.
[20] Das »Expertenverfahren« ist dokumentiert in drei vom Senator für Stadtentwicklung rasch herausgegebenen Berichtsbänden: Werkstattbericht zum Hearing vom 10. bis 14. Oktober 1981 (Anm. 19); Werkstattbericht zum Symposion am 13. und 14. November 1981, Berlin 1981; Dokumentation des Experten-Verfahrens von Oktober bis Dezember 1981, Bd. 1: Gutachten; Bd. 2: Stellungnahmen, Berlin 1982. Vgl. auch: »Es fehlt das Gefühl für die Großstadt«, in: Spiegel, 9.11.1981, S. 235-242; Manfred Sack, Neue Liebe für das störrische Kind, in: ZEIT, 18.12.1981, S. 37.
[21] Dokumentation, Bd. 2: Stellungnahmen (Anm. 20), S. 93 (A. Carlini).
[22] Die Fragen stellten die Experten M. Bächer (Stuttgart), E. Kossak (Hamburg) bzw. J. Engel (Amsterdam), in: Werkstattbericht zum Symposion (Anm. 20), S. 6ff.
[23] Thomas Sieverts, Sieben einfache Fragen, in: Bauwelt 72 (1981), S. 2188-2191, hier S. 2189.
[24] Walther Schmidt, Probleme des Wiederaufbaus, in: Bauwelt 72 (1981), S. 2186ff., hier S. 2186.
[25] Gutachten Edvard Jahn, in: Dokumentation, Bd. 1: Gutachten (Anm. 20), S. 76.
[26] Schlusche, Die Internationale Bauausstellung (Anm. 4), S. 132.
[27] Dankwart Guratzsch, Freie Fahrt für Kleihues, in: Die Welt, 19.12.1981.
[28] Rahmenkonzept für den Bereich der IBA-Neubaugebiete (5.3.1982), in: Dokumentation, Bd. 1: Gutachten (Anm. 20), S. 126f.; dort auch die folgenden Zitate.
[29] Hanno Klein, Das Planungsverfahren Zentraler Bereich, Grundlagen und Ziele, in: Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hg.), Die räumliche Ordnung des Zentralen Bereichs. Entwicklungsgrundlagen und Konzepte, Berlin 1985, S. 12-23, hier S. 16.
[30] Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hg.), Zentraler Bereich. Dokumentation der Vorträge zum 1. Kolloquium am 7. und 8. Mai 1982 in der Amerika-Gedenkbibliothek, Berlin 1982, S. 1.
[31] Günther Kühne, Findet die IBA ihren Weg?, in: Tagesspiegel, 16.10.1981.
[32] Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hg.), Dokumentation zum Planungsverfahren Zentraler Bereich, Berlin 1983, S. 12f.
[33] Hans Stimmann an Kerngruppe, 9.3.1983, in: Dokumentation (Anm. 32), S. 60.
[34] Ebd., S. 61f. (Hervorhebung im Original).
[35] Dieter Hoffmann-Axthelm, Berliner Zentrum, in: Bauwelt 72 (1981), S. 2175-2185, hier S. 2175.
[36] Briefe Hoffmann-Axthelm (31.10.1982) und Posener (1.11.1982), in: Dokumentation (Anm. 32), S. 68-72.
[37] Klein, Das Planungsverfahren (Anm. 29), S. 22f.; Stimmann an Kerngruppe (Anm. 33), S. 60.
[38] Hanno Klein kam 1991 bei einem nie aufgeklärten Briefbombenanschlag ums Leben.
[39] Gutachten Gerd Neumann, in: Dokumentation (Anm. 32), S. 176-203, hier S. 180f.
[40] Wolf Jobst Siedler, Zwischenruf, in: Bauwelt 75 (1984) H. 5-6, S. 178.
[41] Ebd.
[42] Edvard Jahn, Konzepte zur räumlichen Ordnung, in: Senator, Die räumliche Ordnung (Anm. 29), S. 24-85, hier S. 27.
[43] Ebd., S. 68.
[44] Ebd., S. 67.
[45] Gutachten Gerd Neumann (Anm. 39), S. 181.
[46] Dittmar Machule/Hans Stimmann, Wofür braucht Berlin eine neue Mitte, in: Berliner Stimme, 5.12.1980 (wieder abgedruckt in: Dokumentation [Anm. 32], S. 229).
[47] Julius Posener an Kerngruppe, 22.2.1983, in: Dokumentation (Anm. 32), S. 62ff., hier S. 64.
[48] Senator, Die räumliche Ordnung (Anm. 29), S. 3.
[49] Jahn, Konzepte (Anm. 42), S. 57.
[50] Gutachten Andreas Reidemeister, in: Dokumentation (Anm. 32), S. 204-218, hier S. 211.
[51] Posener an Kerngruppe, 31.10.1982, in: Dokumentation (Anm. 32), S. 70.
[52] Stimmann an Kerngruppe, 9.3.1983, in: Dokumentation (Anm. 32), S. 60.
[53] Berliner Geschichtswerkstatt (Hg.), Projekt: Spurensicherung. Alltag und Widerstand im Berlin der 30er Jahre, Berlin 1983; Adelheid von Saldern, Stadtgedächtnis und Geschichtswerkstätten, in: WerkstattGeschichte 50 (2008), S. 54-68.
[54] Werkstattbericht zum Symposion (Anm. 20), S. 12 (Hoffmann-Axthelm).
[55] Vgl. den Leserbrief von Wolfgang Schäche in: Bauwelt 72 (1981), S. 2118.
[56] Karen Till, The New Berlin. Memory, Politics, Place, Minneapolis 2005, S. 63-105.
[57] Kleihues, IBA (Anm. 9).
[58] Till, The New Berlin (Anm. 56); Brian Ladd, Ghosts of Berlin. Confronting German History in the Urban Landscape, Chicago 1997; Jennifer A. Jordan, Structures of Memory. Understanding Urban Change in Berlin and Beyond, Stanford 2006; Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999.
[59] Hoffmann-Axthelm, Berliner Zentrum (Anm. 35); dort auch die folgenden Zitate.
[60] Helge Pitz/Wolfgang Hofmann/Jürgen Tomisch (Hg.), Berlin-W. Geschichte und Schicksal einer Stadtmitte, 2 Bde., Berlin 1984.
[61] Ebd., Bd. 1, S. 2.
[62] Klein, Das Planungsverfahren (Anm. 29), S. 15.
[63] Hans Joachim Reichhardt/Wolfgang Schäche, Von Berlin nach Germania. Über die Zerstörungen der »Reichshauptstadt« durch Albert Speers Neugestaltungsplanungen. Katalog zu einer Ausstellung des Landesarchivs Berlin vom 7. November 1984 bis 30. April 1985, Berlin 1984.
[64] Pitz/Hofmann/Tomisch, Berlin-W (Anm. 60), Bd. 1, S. 412.
[65] Ebd., S. 417; dort auch die folgenden Zitate.
[66] Dokumentation, Bd. 2: Stellungnahmen (Anm. 20), S. 9, S. 11 (Josef Paul Kleihues bzw. Wolfgang Hofmann).
[67] Dokumentation (Anm. 32), S. 237f.
[68] Pitz/Hofmann/Tomisch, Berlin-W (Anm. 60), Bd. 1, S. 2.
[69] Bericht der Kerngruppe; zit. nach Bauwelt 75 (1984) H. 5-6, S. 186.
[70] Gutachten Reidemeister (Anm. 50), S. 205.
[71] Bericht der Kerngruppe (Anm. 69), S. 197.
[72] Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hg.), Wettbewerb »Platz der Republik«. Ausschreibung, Berlin 1985, S. 20, S. 48.
[73] Horst Vetter, Vorwort, in: Pitz/Hofmann/Tomisch, Berlin-W (Anm. 60), Bd. 1, S. v-vi, hier S. v.
[74] Gutachten Neumann (Anm. 39), S. 181.
[75] Notiz Bernhard Schneider, 15.3.1982, in: Dokumentation (Anm 32), S. 8f.
[76] Schmidt, Probleme (Anm. 24).
[77] Kühne, Findet die IBA ihren Weg? (Anm. 31).
[78] Sieverts, Sieben einfache Fragen (Anm. 23), S. 2191.
[79] Florian Urban, Berlin/DDR – neohistorisch. Geschichte aus Fertigteilen, Berlin 2007; Bruno Flierl, Berlin baut um – Wessen Stadt wird die Stadt?, Berlin 1998.
[80] Hertweck, Berliner Architekturstreit (Anm. 5).
[81] Hierzu mit weiteren Literaturhinweisen: Krijn Thijs, Drei Geschichten, eine Stadt. Die Berliner Stadtjubiläen 1937–1987, Köln 2008, S. 162-196.
[82] Christoph Stölzl (Hg.), Deutsches Historisches Museum. Ideen – Kontroversen – Perspektiven, Frankfurt a.M. 1988, S. 55-244.
[83] Vgl. Bauwelt 77 (1986) H. 6: Reichstag-Operationen; Manfred Sack, Berlin trumpft auf, in: ZEIT, 6.12.1985, S. 51; Karl-Heinz Krüger, »Wir planen hier nicht Kleinkleckersdorf«, in: Spiegel, 25.11.1985, S. 64-71.
[84] Der Architektenwettbewerb für das neuzubauende DHM wurde aber ausgeschrieben; der Sieger war im Juni 1988 Aldo Rossi. Vgl. Stölzl, Deutsches Historisches Museum (Anm. 82), S. 663-696.



![Kleihuesʼ Rahmenplan – oben der damalige Ist-Zustand, unten die vorgeschlagene Gestaltung. Durch Blockrandbebauung rehabilitierte die IBA historische Straßenverläufe und erfand in Mauernähe auch einige neu. (aus: Josef Paul Kleihues, Sieben Essentials zum Rahmenplan für die Neubaugebiete der Internationalen Bauausstellung Berlin, in: Bauwelt 72 [1981], S. 1589-1595, hier S. 1590f.)](/sites/default/files/medien/cumulus/2014-2/Thijs/resized/2188.jpg)
![Kleihuesʼ Rahmenplan – oben der damalige Ist-Zustand, unten die vorgeschlagene Gestaltung. Durch Blockrandbebauung rehabilitierte die IBA historische Straßenverläufe und erfand in Mauernähe auch einige neu. (aus: Josef Paul Kleihues, Sieben Essentials zum Rahmenplan für die Neubaugebiete der Internationalen Bauausstellung Berlin, in: Bauwelt 72 [1981], S. 1589-1595, hier S. 1590f.)](/sites/default/files/medien/cumulus/2014-2/Thijs/resized/2191.jpg)

![Fragende Blicke: Ortsbesichtigung im Spreebogen am Reichstag, 19. Juni 1986. In der vorderen Reihe (2. von rechts) ist Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) zu erkennen. (Landesarchiv Berlin, Kasperski, Edmund, F Rep 290 [02], Nr. 0277122)](/sites/default/files/medien/cumulus/2014-2/Thijs/resized/2193.jpg)
![Desolate Realität: Eine Schulklasse läuft von einer Aussichtsplattform in Richtung Lenné-Dreieck, 30. Januar 1986. Auf der Mauer rechts hinten im Bild steht der Satz »Deutschland ist hier«. (Landesarchiv Berlin, Siegmann, Horst, F Rep 290 [02], Nr. 0274460)](/sites/default/files/medien/cumulus/2014-2/Thijs/resized/2194.jpg)


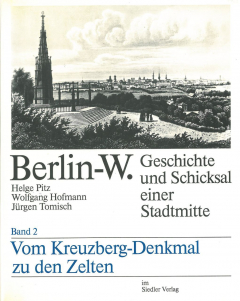
![Ein Vorzeigeprojekt am vernachlässigten Stadtrand: die Probestrecke der Magnetbahn im März 1987. Rechts ist das Weinhaus Huth zu erkennen, im Hintergrund die Berliner Mauer mit Wachturm. Die Strecke führte vom Gleisdreieck (Kreuzberg) über die Station Bernburger Straße bis zum Kemperplatz (Tiergarten). 1991 wurde die gesamte Anlage demontiert. (Landesarchiv Berlin, Kasperski, Edmund, F Rep 290 [02], Nr. 0290294)](/sites/default/files/medien/cumulus/2014-2/Thijs/resized/2198.jpg)
![Am 28. Oktober 1987 enthüllten der Bundeskanzler und der Regierende Bürgermeister im leeren Spreebogen die Stiftungstafel des Deutschen Historischen Museums. Wandel und Kontinuität im folgenden Zeit-Raum verdichteten sich in diesem Grundstein: Er wurde 1990 stillschweigend entfernt. Zehn Jahre nach seiner symbolischen Enthüllung, und an ziemlich genau derselben Stelle, stach derselbe Kanzler 1997 den ebenso symbolischen ersten Spaten in den Boden – für das Bundeskanzleramt. (Landesarchiv Berlin, Kasperski, Edmund, F Rep 290 [02], Nr. 0291362)](/sites/default/files/medien/cumulus/2014-2/Thijs/resized/2199.jpg)