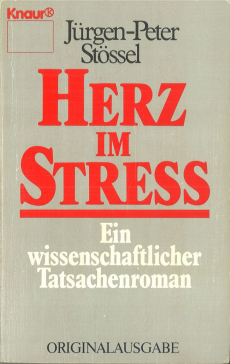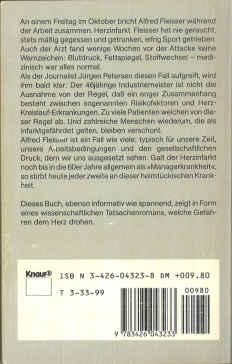Jürgen-Peter Stössel, Herz im Streß. Ein wissenschaftlicher Tatsachenroman. Auf der Grundlage eines Forschungsberichts von Franz Friczewski u.a., München: Knaur 1986.
Seit den 1960er-Jahren ist die Kopplung von Stress und Vorsorge unter dem Stichwort der »Risikofaktoren« zunehmend populär geworden. Wahrscheinlichkeitskalküle, die auf die Steuerung und Verbesserung der kollektiven Gesundheit der Bevölkerung zielen, werden als Grundlage herangezogen, um dem Individuum eine Selbstverantwortlichkeit für seine Risikovorsorge zuzuschreiben. Dieser Ansatz ermöglicht die Übersetzung statistischer Wahrscheinlichkeiten in eine Hermeneutik des Selbst. Im Rahmen der Prävention verschiebt sich der Akzent von der Krankheitsdiagnostik auf die Gesundheitsvorsorge. Durch die Propaganda zur Risikoverhütung – dass der Gesunde pathogene Faktoren vermeiden solle – verschwimmt allerdings die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit. Das gilt auch für das Phänomen Stress. Obschon Stress selbst nicht als Krankheit gilt, wird in ihm doch ein potentieller Verursacher vermutet: eben ein »Risikofaktor«. Und auch wenn er damit als mögliche Ursache für viele Krankheiten verhandelbar wird, gibt es bestimmte pathologische Erscheinungen, mit denen er eine besonders innige Beziehung unterhält – dazu zählt der Herzinfarkt. Dieser wird zum Synonym für die Folgen eines von zu viel Stress bestimmten Lebens. Die Relation von Stress und Herzinfarkt lässt sich nicht nur medizinisch begründen; ihre kulturelle Plausibilität verweist auch auf eine symbolische Dimension. Das Herz als symbolischer Träger menschlicher Aktivität und Emotionalität gerät unter dem Eindruck der modernen Hetze außer Takt.[1]
Der 1986 erschienene »wissenschaftliche Tatsachenroman« »Herz im Streß« verdichtete sowohl die Verschlungenheit wie die Widersprüchlichkeit der sich um den Herzinfarkt entspinnenden Diskurse, Praktiken und Selbstsorgeprogramme. Es handelt sich um eine Auftragsarbeit des Wissenschaftsjournalisten und Schriftstellers Jürgen-Peter Stössel, welcher der breiten Öffentlichkeit die Resultate einer am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) durchgeführten Studie über den Zusammenhang von Herzinfarkt und den Verhältnissen an industriellen Arbeitsplätzen vermitteln sollte.[2] Als medizinisches Aufklärungsbuch, Gesundheitsratgeber und Kritik an der herkömmlichen Sozialmedizin konzipiert, liest sich der Roman wie ein investigativer Bericht aus dem Herzen der Risikogesellschaft. Geschrieben ist er aus zwei Perspektiven: einerseits aus Sicht der betroffenen Herzinfarktpatienten, durchweg Industriearbeitern, und andererseits aus Sicht des Wissenschaftsjournalisten Jürgen Petersen, der ausgehend von diesem Phänomen dem Zusammenhang von Stress, Herzinfarkten, Arbeitsverhältnissen und ihrer medizinischen Behandlung nachrecherchiert.
Ausgangspunkt des Romans ist die Beobachtung, dass der Herzinfarkt auch Patienten betrifft, die nicht zu den klassischen Risikogruppen gehören – besonders Industriearbeiter. Petersen stößt bei seiner Recherche darauf, dass den bisherigen medizinischen und psychologischen Theorien von der Entstehung dieser Krankheit »die Verbindung zu den objektiven Bedingungen, unter denen der Mensch lebt und arbeitet, der gesellschaftliche Bezug« fehle (S. 112). Auf einer Tagung, die der Journalist besucht, wird er Zeuge der Kontroverse zwischen Arbeitsmedizinern und Sozialwissenschaftlern, die sich im Kern um die Reichweite und Relevanz möglicher soziologischer Entstehungsmodelle von Herzinfarkten dreht. Die Soziologen werfen der Arbeitsmedizin vor, sie blockiere »eine fruchtbare wissenschaftliche Auseinandersetzung mit industriell produzierten Belastungen und ihren individuellen wie gesellschaftlichen Folgen, indem sie die Schwelle für den Beweis eines ursächlichen Zusammenhangs so hoch schraubt, daß sie letztlich nie zu überwinden sein wird« (S. 156). Das ermögliche es, die Wirtschaft von jeder Verantwortung für die stressbedingten gesundheitlichen Folgen von Überbelastungen am Arbeitsplatz freizusprechen. Stattdessen werde der betroffene Mitarbeiter für schuldig erklärt, da seine fehlgeleitete persönliche Stressbewältigungsstrategie als maßgeblicher Grund für die Überbelastung ausgewiesen werde.
Fasziniert von der Vorstellung, Infarkte seien nicht nur Folge eines bestimmten Persönlichkeitsprofils, schlechter Angewohnheiten und übermäßigen Konsums, stößt Petersen auf den »Forschungsbericht Herz-Kreislauf-Krankheiten und industrielle Arbeitsplätze«, eine statistische Untersuchung über den möglichen Zusammenhang von Herzinfarkten und Arbeitsumfeld. Auch wenn Petersen es »auf halber Strecke« aufgibt, »sich zurechtzufinden im Gestrüpp der unzähligen Daten«, entnimmt er dem Bericht doch, »daß die Arbeitsbedingungen für die Infarktentstehung mindestens die gleiche Bedeutung haben wie die medizinischen Risikofaktoren« (S. 220f.). Der Bericht weist darauf hin, dass für den Herzinfarkt ein ganzes »Ursachenbündel« verantwortlich sei (ebd.). Als besondere Risikogruppen werden allerdings die unteren Vorgesetzten ausgemacht. Sie stehen unter dem doppelten Druck ihrer Chefs und ihrer Untergebenen; zudem sollen sie betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen umsetzen, die zugleich auch sie selber betreffen. Entsprechend bestimmen ihre Krankengeschichten den Roman.
Dieser entstand im Kontext einer intensivierten Forschung über die Ausbreitung von Herzkreislaufkrankheiten und die dafür verantwortlichen »Risikofaktoren«.[3] Entscheidende Übersetzungsarbeit, um das Konzept der Risikofaktoren auch in der Bundesrepublik bekannt zu machen, leisteten am Heidelberger Institut für Arbeits- und Sozialmedizin die Mediziner Hans Schaefer und Maria Blohmke, deren Zusammenarbeit sich im gemeinsam geschriebenen Buch »Herzkrank durch psychosozialen Streß« (1977) niederschlug. Sie griffen dafür auf die Daten einer mit amerikanischen Untersuchungsmethoden durchgeführten Modellstudie von Blohmke zurück.[4] Die Resultate solcher Studien wirkten, wie Schaefer sich im Klaren war, zunächst einmal irritierend auf die Leser, da die »Zuordnung vieler Schädlichkeiten zu denjenigen Krankheiten, die man bislang als Folge jener Schäden ansah«, nur auf statistischer Wahrscheinlichkeit beruhe, nicht aber auf medizinisch nachweisbaren kausalen Zusammenhängen: »Man erforscht die Lebensgewohnheiten der Menschen, ihre Lebensgeschichte und sucht nun mit Hilfe elektronischer Rechenmaschinen, ob zwischen bestimmten Beobachtungen und bestimmten Krankheiten oder gar Todesursachen eine mehr als zufällige Beziehung besteht.«[5] Entsprechend führten die korrelationsstatistischen Untersuchungen zur Erkenntnis, dass es »offenbar das Zusammenwirken mehrerer schädigender Faktoren« sei, »das unser Herz tödlich trifft« – konkret »die Häufung von Überernährung, Zigarettenrauchen, Bewegungsarmut, Lärm und geistiger Spannung«, typische Belastungen des »moderne[n] Mensch[en]«.[6]
Obwohl die »Risikofaktoren«, die im Rahmen einer 1947 begonnenen Langzeituntersuchung über Herzkreislaufkrankheiten in der amerikanischen Kleinstadt Framingham erstmals beschrieben und definiert wurden,[7] Wahrscheinlichkeiten verkörpern, erfuhren sie bei Blohmke und Schäfer eine Interpretation, als seien sie ontologische Krankheitsursachen. Die beiden Mediziner interpretierten den »Risikofaktor« wechselweise als »Indikator der Krankheit, die er bewirkt«,[8] dann wieder als die Krankheitsursache selbst. Basierend auf einem Kausalitätsmodell, das auf die bakteriologische Epidemiologie der Infektionskrankheiten rekurrierte, entstand der Eindruck, es genüge, die Ursachen zu beseitigen, um auch chronische Leiden wie Herzkreislaufkrankheiten heilen zu können.[9] Diese Unschärfe des Konzepts hatte Kalkül, denn wenn kollektive »Risikofaktoren« als individuelle Gefährdungen erscheinen, gibt es für die betroffenen Personen einen Anreiz, sie zu bekämpfen.
Kritische Mediziner wie Dieter Borgers wandten deshalb schon früh ein, mit dem Konzept der »Risikofaktoren« werde ohne epistemologische Rechtfertigung »ein großer Teil der Bevölkerung für potentiell krank und behandlungsbedürftig erklärt«.[10] Die epistemologischen Mängel solcher Konzepte erklären allein jedoch nicht die harsche Kritik. Was sich ereignete, war vielmehr ein Wettstreit der Experten, insbesondere zwischen Medizinern und Soziologen. Nach der Physiologisierung und Psychologisierung von Stress erfolgte nunmehr auch seine Soziologisierung. Dass es um die Gesundheit und nicht länger um die Krankheit der Bevölkerung ging, bedeutete zugleich, dass die Autorität der Mediziner in Frage gestellt wurde und weitere Experten ins Spiel kamen: etwa Sozialwissenschaftler, die ihre Expertise für die Gesundheit als von sozialen Variablen abhängiges Phänomen zur Verfügung stellten, Medienexperten, die mit der Gesundheitsaufklärung beauftragt waren, oder Ratgeber, welche die Übersetzung medizinischer Theorien, sozialer Erhebungen und subjektiver Befindlichkeiten leisteten.[11] Im entgrenzten diskursiven Feld der Gesundheit galt und gilt Stress dementsprechend nicht länger nur als eine medizinische, sondern ebenso als eine soziale und kulturelle Tatsache.[12]
Stössels »Tatsachenroman« beschrieb dieses diskursive Feld nicht nur, er trug auch selbst zu dessen Entgrenzung bei. Mit den Industriearbeitern rückte der Roman, der WZB-Studie folgend, eine neue, nun anscheinend auch von Stress betroffene Risikogruppe in den Blick. Wie die amerikanische Kolumnistin Barbara Ehrenreich 1984 argumentierte, war das Herz zunächst das »Symbol für die Anfälligkeit der Männer angesichts der bürokratischen kapitalistischen Gesellschaft«.[13] Der Herzinfarkt lasse die Männer als das neue kranke Geschlecht in den Mittelpunkt treten. Berufskarriere, Leistungsbereitschaft, Familiengründung und exzessiver Konsum, kurzum all das, was auf gelingendes männliches Leben hindeutete, wurde seit den 1950er-Jahren zunehmend als Symptom für dessen Verletzlichkeit und Hinfälligkeit gedeutet. Damit wurde es auch möglich, die Belastungen von Bürotätigkeit, also nichtphysischer Arbeit, zu thematisieren und zu dokumentieren.[14] Der Infarkt galt als sichtbares Zeichen des Arbeitsstresses, dem gerade »Kopfarbeiter« ausgesetzt seien.[15] Der Roman und die WZB-Studie leisteten, indem sie nun auch den Stress von Fabrikarbeitern untersuchten, ebenso einen Beitrag zur kritischen Relativierung des Risikofaktorenkonzepts wie zu seiner affirmativen Plausibilisierung.
Wie Stössel selbst schreibt, ist sein Buch als »eine Art dokumentarische[r] Roman« angelegt, dessen Handlung sich vor dem Hintergrund der industriellen Arbeitswelt entfaltet und statistische Daten »zu Schicksalen verdichtet«.[16] Dass er sich damit dem von Botho Strauß geäußerten Vorwurf eines »flachen Sozialkritizismus« aussetzte, nahm er hin.[17] Doch der Roman geht über den Anspruch des Dokumentarischen hinaus, er will Ratgeber sein, die gestressten Arbeiter aufklären, wobei auch das Taschenbuchformat helfen soll.[18] Er adressiert und beschreibt die Arbeiter als Subjekte, denen ein Selbstsorgeprogramm mit auf den Weg gegeben wird, das es ihnen erlaube, einen guten subjektiven Umgang mit Belastungen durch die starren Strukturen ihrer Arbeitsumwelt zu finden. Implizit verbindet sich im Roman damit die Frage nach dem Ausgang aus dem Stress der organisierten Moderne,[19] mithin die Frage nach alternativen Arbeitsformen. Eine solche Alternative scheint bei Stössel jedoch eher beiläufig auf. Sie wird verkörpert durch den ermittelnden Journalisten, für den seine Tätigkeit Selbsterfüllung, mit anderen Worten eine Form der subjektivierten Arbeit bedeutet.
Klarer ist die Alternative bei Franz Friczewski formuliert, einem der an der WZB-Studie beteiligten Wissenschaftler, der die Resultate der Untersuchung in einem ebenfalls an die breitere Öffentlichkeit gerichteten Buch verarbeitete. Als Mittel, um die krankmachenden Arbeitsverhältnisse zu reformieren, schlug er 1988 deren Flexibilisierung vor.[20] Friczewski und Stössel standen damit am Übergang vom Stress der organisierten Moderne zum Stress des Zeitalters der Flexibilisierung.[21] Im Roman finden sich entsprechend auch schon Spuren eines neuen Stresses, doch der Umstand, dass Petersen, wie seine Lebensgefährtin bemerkt, die Arbeit zuweilen »über den Kopf wächst«, bleibt im Text weitgehend unreflektiert (S. 107). Der Druck, dem Petersen, als Journalist Prototyp der Informationsgesellschaft, durch Projektbasiertheit, Kreativitätsanforderungen und flexible Arbeitszeiten ausgesetzt ist,[22] rückt auch deshalb nicht in den Blick, weil es sich, wie immer wieder betont wird, um einen selbstinduzierten Druck handle, welcher der eigenen Motivation geschuldet sei, aus dem selbstgewählten Thema etwas zu machen. Der Stress des Journalisten erscheint somit als Produkt just jener persönlichen Freiheit und Autonomie, von der sich die Wissenschaftler einen Ausweg aus dem Stress der organisierten Moderne versprachen.[23] Die subjektivierte Arbeit eröffnete daher auch den Weg von einer Pathologie der Entfremdung von Individuum und Organisation zu einer Pathologie der Überidentifikation und Selbstüberforderung, wie sie für das Sprechen über »Burnout« charakteristisch werden sollte.[24]
Während diese neue Form von Stress bei Stössel weitgehend unartikuliert blieb, machten ihn andere Schriftsteller bereits zum Thema, wirft man einen Blick in die um 1980 gleichzeitig en vogue befindliche Literatur der Neuen Subjektivität.[25] Dafür wählten sie jedoch nicht den Tatsachenroman, sondern mit dem Journal eine andere Form der dokumentarischen Berichterstattung aus dem Alltag – ein Aufzeichnungsmedium, das es ermöglicht, Introspektion und Umweltbeobachtung miteinander zu verbinden. In solchen Formen der Selbstmedialisierung wurde Stress als neue Krankheit des Schriftstellers kenntlich, der sich so als Vertreter und Vorreiter der kreativen Informationsgesellschaft zu erkennen gab. 1987 notierte Rolf Dieter Brinkmann entsprechend: »Der Streß wird größer. Je mehr ich denke.«[26]
Hinweis der Redaktion und der Herausgeber dieses Hefts: Robert Suter ist am 11. September 2014 gestorben.
[1] Deutlich wird diese Kritik an der Moderne, die das dem Zeitalter der Technisierung und Beschleunigung angeblich nicht gewachsene menschliche Herz in ihr Zentrum stellt, schon im Diskurs um die Managerkrankheit in den 1950er-Jahren. Vgl. dazu Patrick Kury, Der überforderte Mensch. Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout, Frankfurt a.M. 2012, S. 109-176. Zur Geschichte des literarischen Motivs Herzinfarkt vgl. Robert Suter, Dichter mit Herzinfarkt. Vom Stress der organisierten Moderne zum Stress der Flexibilisierung, in: Miriam Lay Brander/Stephanie Kleiner/Leon Wansleben (Hg.), Unwahrscheinliche Gegenwarten. Kulturelle Praktiken von Aufmerksamkeit, München 2015 (in Vorbereitung).
[2] Vgl. Jürgen-Peter Stössel, Tage-Buch zu »Herz im Streß. Ein wissenschaftlicher Tatsachenroman«, in: Kürbiskern Nr. 4/1986, S. 48-58, hier S. 51. Auf Stössel aufmerksam geworden waren die Auftraggeber wegen seines Buchs über psychosomatische Medizin: Wenn Pillen allein nicht helfen. Erfahrungen mit der psychosomatischen Medizin, München 1984.
[3] Hierfür grundlegend: Carsten Timmermann, Risikofaktoren. Der scheinbar unaufhaltsame Erfolg eines Ansatzes aus der amerikanischen Epidemiologie in der deutschen Nachkriegsmedizin, in: Martin Lengwiler/Jeannette Madarász (Hg.), Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik, Bielefeld 2010, S. 251-277; Uta Gerhardt/Hannes Friedrich, Risikofaktoren, primäre Prävention und das Problem des richtigen Lebens. Zur Funktion der Soziologie in der Medizin, in: Medizinische Soziologie, Jahrbuch 1985, S. 107-127.
[4] Vgl. Timmermann, Risikofaktoren (Anm. 3), S. 267f.
[5] Hans Schaefer, Das kranke Herz als Symptom unseres Lebens, in: Das kranke Herz. 12 Beiträge, München 1965, S. 9-24, hier S. 15f. Insofern handelt es sich hier um eine Forschungsrichtung, die eng mit der Computerisierung verbunden war.
[6] Ebd., S. 20f.
[7] Vgl. Timmermann, Risikofaktoren (Anm. 3), S. 255.
[8] Maria Blohmke/Hans Schaefer, Herzkrank durch psychosozialen Streß, Heidelberg 1977, S. 41.
[9] Vgl. dazu Thomas Schlich, Einführung: Die Kontrolle notwendiger Krankheitsursachen als Strategie der Krankheitsbeherrschung im 19. und 20. Jahrhundert, in: ders./Christoph Gradmann (Hg.), Strategien der Kausalität. Konzepte der Krankheitsverursachung im 19. und 20. Jahrhundert, Pfaffenweiler 1999, 2. Aufl. Herbolzheim 2004, S. 3-28.
[10] So die Zusammenfassung bei: Timmermann, Risikofaktoren (Anm. 3), S. 272.
[11] Vgl. hierzu Jost Bauch, Gesundheit als sozialer Code. Von der Vergesellschaftung des Gesundheitswesens zur Medikalisierung der Gesellschaft, Weinheim 1996; John O’Neill, Die fünf Körper. Medikalisierte Gesellschaft und Vergesellschaftung des Leibes, München 1990.
[12] Zu Stress als kultureller Tatsache vgl. Petja Handkova/Tobias Ringeisen/Frederick T.L. Leong (Hg.), Handbuch Stress und Kultur. Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven, Wiesbaden 2013.
[13] Barbara Ehrenreich, Die Herzen der Männer. Auf der Suche nach einer neuen Rolle, Reinbek bei Hamburg 1984, S. 80.
[14] Auf die Gültigkeit dieser These auch für den deutschen Sprachraum verweist u.a. folgende Publikation: Michael Frese (Hg.), Streß im Büro, Bern 1981.
[15] Vgl. Ehrenreich, Herzen der Männer (Anm. 13), S. 83.
[16] »Monatliche Honorarzahlungen«, schreibt er über seine persönliche Motivation, das Buch zu verfassen, »nach Tarifen des Öffentlichen Dienstes, das waren für einen freiberuflichen Schreiber höchst beflügelnde Aussichten.« Stössel, Tage-Buch (Anm. 2), S. 51.
[17] Ebd., S. 50.
[18] Im medialen Kontext jener Zeit wirkte dieses Verfahren allerdings antiquiert. Ungleich erfolgreicher als Stössel war beispielsweise Frederic Vester. Er setzte auf eine multimediale Aufklärungskampagne über Stress, die in der Hauptsache aus einer mehrteiligen Fernsehdokumentation und einer Begleitpublikation bestand, die zum Bestseller wurde. Vgl. Frederic Vester, Phänomen Stress. Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet?, Stuttgart 1976 (und öfter). In einer Rezension von Stössels Buch wurde denn auch bezweifelt, ob es seinen Aufklärungszweck erfüllen könne. Vielmehr vermutete die Rezensentin, die anvisierten Leser würden »auf halbem Wege« aufgeben, »dort nämlich, wo sich die Handlung für einige Zeit im Gestrüpp von Kongreßdebatten verliert«. Ingrid Schultz, Infarkt am Arbeitsplatz: Herz im Streß, in: ZEIT, 21.3.1986.
[19] Ein zeitgenössischer Überblick zur diesbezüglichen Forschung findet sich bei: Diether Gebert, Belastung und Beanspruchung. Ergebnisse der Streß-Forschung, Stuttgart 1981.
[20] Franz Friczewski, Sozialökologie des Herzinfarkts. Untersuchungen zur Pathologie industrieller Arbeit, Berlin 1988, S. 83. Zum erst positiv konnotierten Konzept der Flexibilisierung vgl. Luc Boltanski/Eve Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003, S. 243; zur negativen Umwertung von Flexibilisierung in Deutschland während der 1990er-Jahre vgl. Oskar Negt, Flexibilität und Bindungsvermögen. Grenzen der Funktionalisierung, in: Alexander Meschnig/Mathias Stuhr (Hg.), Arbeit als Lebensstil, Frankfurt a.M. 2003, S. 13-25, hier S. 17; ein Lob der Flexibilisierung findet sich u.a. bei Karl H. Hörning/Anette Gerhard/Matthias Michailow (Hg.), Zeitpioniere. Flexible Arbeitszeiten – neuer Lebensstil, Frankfurt a.M. 1990.
[21] Dass im »Übergang zur postindustriellen Zivilisation [...] die Zunahme stressbedingter Zivilisationskrankheiten« festzustellen sei, war schon eine zeitgenössische Diagnose. Bernhard Badura/Holger Pfaff, Streß, ein Modernisierungsrisiko? Mikro- und Makroaspekte soziologischer Belastungsforschung im Übergang zu postindustriellen Zivilisation, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 41 (1989), S. 644-668, hier S. 663.
[22] Hierzu grundlegend: Pierre-Michel Menger, Kunst und Brot. Die Metamorphosen des Arbeitnehmers, Konstanz 2006; Andreas Reckwitz, Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Berlin 2012.
[23] Zu diesem Postulat der Stressforschung vgl. u.a. Eberhard Ulich, Möglichkeiten autonomieorientierter Arbeitsgestaltung, in: Frese, Streß im Büro (Anm. 14), S. 159-178.
[24] Vgl. Sighard Neckel/Greta Wagner (Hg.), Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Frankfurt a.M. 2013.
[25] Stössels Roman gehört dagegen als vorgeblicher Tatsachenbericht eher in die Traditionslinie der Sozialreportagen, etwa Günter Wallraffs früher Industriereportagen oder der »Bottroper Protokolle«. Mit ihnen teilt er die Emphase des Erlebnisses, nur dass nunmehr die industrielle Umwelt nicht per se krank macht, sondern dass es die subjektiven Bewältigungsmechanismen sind, mit denen die Arbeiter ihr Schicksal bis zu einem gewissen Grad selbst verursachen. Vgl. Günter Wallraff, Wir brauchen dich. Als Arbeiter in deutschen Industriebetrieben, München 1966; Bottroper Protokolle, aufgezeichnet von Erika Runge, Frankfurt a.M. 1968.
[26] Rolf Dieter Brinkmann, Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand: Träume / Aufstände / Gewalt / Morde. Reise Zeit Magazin (Tagebuch), Reinbek bei Hamburg 1987, S. 360.